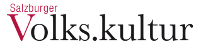

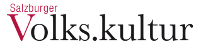

„Denn ist es etwa nicht wahr, daß auch in unseren Lebensszenarien die Widersprüche stärker sind als der Faden, den wir dem Ding gern geben möchten?“ (Adolf Muschg: Wo alles aufhört, beginnt das Spiel. Gedanken über Mozarts Zauberflöte)
„An byzantinischen Höfen hat es allmächtige Eunuchen gegeben, wie es immer Kritiker und Dekonstruktionisten mit einer anmaßenden Haltung gegenüber schöpferischer Tätigkeit gegeben hat. Doch die grundlegende Unterscheidung bleibt.” (Georges Steiner: Von realer Gegenwart)
Wenn heute immer noch Diskurse darüber angestellt werden, ob Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte”[614] ein Machwerk sei oder nicht; wenn naserümpfend bisweilen halb unausgesprochen die Berechtigungsfrage gestellt wird; wenn sich diese Überheblichkeit über ein gültiges und im Kern fragloses Kunstwerk zementiert und damit einer lustvollen Begegnung mit (Musik-)Theater den Zugang versagt; dann möchte man, nicht ganz ohne Freude an Polemik, den Entwurf Georges Steiners „eine[r] Gesellschaft, eine[r] Politik des Primären” wieder stärker ins Bewusstsein gerückt wissen: „Eine Stadt für Maler, Dichter, Komponisten oder Choreographen an Stelle einer für Kunst-, Literatur-, Musik- oder Ballettkritiker und -rezensenten, sei es im kommerziell-publizistischen oder im akademischen Bereich.”
Es ist müßig, eine weitere Abhandlung zu all den zu vielen hinzuzufügen (über den berühmten „Bruch”, die Unlogik des dramaturgischen Aufbaus, musikalische Stärken und mögliche Schwächen und worüber sonst besonders kluge Geister glaubten sich den Kopf zerbrechen zu müssen). Meine ganz persönliche Empfehlung: Stefan Kunzes „Mozarts Opern”, Ivan Nagels „Autonomie und Gnade” sowie, mit Nachdruck und vor allen Dingen, Wolfgang Willascheks „Mozart-Theater”: glänzende Bestandsaufnahmen, denen es – so scheint es mir – aus heutiger Sicht kaum etwas hinzuzufügen gilt. Deshalb: Nachlesen, Nachdenken.
Fern jedes akademischen Diskurses siedeln Harry Kupfer und Valeri Lewental im Jahr 2000 die Inszenierung der „Zauberflöte” an: auf dem Theater selbst, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, auf der Pawlatsche. Die Bezeichnung kommt vom tschechischen „pavlac”, was zunächst den offenen Gang an der Hofseite eines Hauses meinte. Im – auch sprachlichen – Schmelztigel Wien wurde sie dann auf die schnell aufgestellten Bretterbühnen der Straßentheater übertragen. So gerät die Pawlatschenbühne zum Synonym für eine theatrale Ursprünglichkeit, zu einer Art Wiener Thespiskarren, von dem der Sprung nicht weit ist zum „eigentlichen” Bestimmungsort jener „Teutschen Oper in 2 Aufzügen”: „Die Zauberflöte”, eine dieser Mozartschen Utopien des Menschseins, hatte in erster Linie „vor der Linie” ihre Heimat: Uraufgeführt im Theater im Starhembergschen Freihause auf der Wieden, weit weg vom Regeldrama und dem ausschließlich – so genannten – hohen Stil; in einem der Wiener Vorstadttheater also, nicht am k.u.k. Nationaltheater nächst der Burg („Le Nozze di Figaro”, „Così fan tutte”), nicht am Prager Altstädter Theater („Don Giovanni”). Doch kaum erhebt man in verklärendem Gegenzug, ihre Herkunft fast schon wieder entschuldigend, die „Zauberflöte” zum Höchsten, was das Wiener Volkstheater elfenbeinturmene Ferne, die ihrer Unmittelbarkeit höchst unrecht tut.” „nur gieng ich auf das theater bey der Arie des Papageno mit dem GlockenSpiel”, berichtet Mozart am 8./9. Oktober 1791 seiner in Baden zur Kur weilenden Frau, „weil ich heute so einen trieb fühlte es selbst zu Spielen. – da machte ich nun den Spass, wie Schickaneder einmal eine haltung hat, so machte ich eine Arpegio – der erschrack – schauete in die Scene und sah mich – als es das 2:te mal kamm – machte ich es nicht – nun hielte er und wollte gar nicht mehr weiter – ich errieth seinen Gedanken und machte wieder einen Accord – dann schlug er auf das Glöckchenspiel und sagte halts Maul – alles lachte dann – ich glaube daß viele durch diesen Spass das erstemal erfuhren daß er das Instrument nicht selbst schlägt.” Mozart, Kindskopf der er auch war, gestattete sich also selbst den einen oder anderen Jux mit der lustigen Figur Papageno, zumindest hinter der Bühne. Diese lustige Figur war die Konstante in der Wiener Komödie, ob sie nun als Hanswurst, Bernardon, Kasperl oder Staberl auftrat, und Papageno ist ein ihrer – freilich harmlosen – Verwandten.
Der Wiener Hanswurst, Sau- und Krautschneider aus Salzburg, steht am Anfang. Er fand seine legendäre Verkörperung in Joseph Anton Stranitzky, einem Marionettenspielunternehmer und Wanderschauspieler aus Graz, der sich 1706 in Wien ansiedelte und ab 1712 mit seiner Truppe der Teutschen Comödianten das neugegründete Kärntnertor-Theater bezog, wo er als Hanswurst die vielfältigen Haupt- und Staatsaktionen durchwandert. „Der Hanswurst hat nie die Macht im Drama”, so skizziert ihn Reinhard Urbach, aber „er ist doch überlegen. Seine Antworten scheinen naiv und sind ironisch. Durch seine Rede hebt er Phrasen auf und entlarvt Geschwätz. Er tut es nicht allein durch seine Worte, sondern durch seine Person. Hanswurst ist das Korrektiv im hochbarocken Schauspiel. Dadurch, daß er mit im Spiel ist, korrigiert er das Pathos der Helden.” – Die Hanswurst-Figur selbst gab es freilich schon seit dem Mittelalter, aber erst mit Stranitzky und – durch ihn – mit den Einflüssen des Arlecchino der italienischen Commedia dell'arte oder auch des Pickelhäring der Englischen Komödianten erwuchs sie zu einer Institution. In ihr hatte das Wiener Volkstheater seinen Träger gefunden.
Nach dem Tod Stranitzkys im Jahre 1726 tritt Gottfried Prehauser (1699–1769) die Hanswurst-Nachfolge an, löst die Figur vom Bauernstand, lässt sie nun unter vielerlei Berufen auch des großstädtischen Lebens auftreten. Die Formen der Komik verfeinern sich, nähern sich wieder mehr der Commedia dell'arte an. Und: Ein allmähliches Aufeinandertreffen von Stegreifspiel und Singspiel zeichnet sich ab. Bevor dann Philipp Hafner (1735–1764) die Wiener Komödie endgültig zur Literaturkomödie formt und somit auch Emanuel Schikaneder den Weg ebnet, bricht um das Jahr 1752 Johann Joseph Felix von Kurz (1717–1784) mit der Gestalt seines Bernardon den Wiener Hanswurst-Streit vom Zaun. Über ihn konnte der Adel, der sich mit dem Hanswurst noch bestens unterhalten hatte, plötzlich nicht mehr lachen. „Bernardon widersprach”, meint Reinhard Urbach, „einem Absolutismus, der sich aufgeklärt zu sein einbildete. Bernardon war selbst absolut. Man tarnte den Kampf gegen ihn als Reform. Alles sollte seine Ordnung haben. Dabei wurde Regulierung mit Strangulierung verwechselt.”
Joseph von Sonnenfels war federführend im Kampf gegen den Hanswurst, der ja doch den Anstand, die Sitte und die gesunde Vernunft empöre. Als dann seine „Briefe über die wienerische Schaubühne” 1768 im Druck erschienen, war das Norma-Edikt Maria Theresias schon gut fünfzehn Jahre alt. Dort hatte es am 17. Februar 1752 geheißen: „Die comödie sollte keine andere compositionen spillen als die aus den französischen oder wälischen oder spanischen theatris herkommen, alle hiesigen compositionen von Bernardon und andren völlig auffzuheben, wan aber einige gutte doch wären von weiskern, sollen selbe ehender noch gelesen werden und keine equivoques noch schmutzige Worte darinnen gestattet werden, auch denen comödianten ohne straffe nicht erlaubet werden sich selber zu gebrauchen.” – Kurz muss Wien verlassen. Als er um 1770 in die Kaiserstadt zurückkehrt, ist die Zeit des Stegreiftheaters vorbei. Doch hartnäckig bleibt das aufmüpfige Potential der lustigen Figur bestehen. Trotz Extemporeverbot, Theaterpolizei und Theaterzensur. Ob nun in Gestalt von Philipp Hafners Hanswurst, Anton Hasenhuths Thaddädl, Adolf Bäuerles Staberl oder Johann La Roches Kasperl: Wie zahm man sie alle auch halten wollte, die grundsätzliche Sprengkraft kollektiven Lachens war nicht zu unterdrücken. Mit dem bestechend scharfen Witz Johann Nestroys sollte diese Entwicklung Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt finden. „Jede Rose an der Nestroy riecht” – meinte Hebbel – „stinkt.”
Reiht man die „Zauberflöte” somit ein in die Tradition des Wiener Volkstheaters – und das muss man -, wollte sie aber auf ihren Komödiencharakter reduzieren, würde man fraglos den Dimensionen des Werkes nicht gerecht. Vorstadttheater meint nicht notwendigerweise Lachtheater. „Die Zauberflöte” ist durchwirkt von einem komödiantischen Pulsschlag, aber sie ist keine Komödie. Keine Posse, auch kein Singspiel. Mozart trägt sie als „eine Teutsche Oper in 2 Aufzügen” in das „Verzeichnüss aller meiner Werke” ein, und der Theaterzettel der Uraufführung weist sie als „grosse Oper in 2 Akten” aus. Zwar konterkariert Papageno auf äußerst wohltuende Weise das steif-zeremonielle Ambiente der Eingeweihten; aber Taminos erbarmungsloser Existenzkrise in der so genannten Sprecherszene (man denke an Idomeneos Verzweiflung: „Spietatissimi Dei!”), Paminas strahlender Todessehnsucht („O dolce morte” sang schon Ilia – die „Hintergrundstrahlung” von „Idomeneo” auch hier) vermag keine lustige Figur der Theaterwelt mehr unbekümmerte Heiterkeit hinzuzugesellen.
Es ist nicht ausschließlich Papageno als einer der Nachfahren des Hanswurst, es ist nicht bloß der (Ur-)Aufführungsort selbst, der die „Zauberflöte” als ein Stück Wiener Volkstheater ausweist. Der gesamte Kosmos des barocken Maschinen-Zauberspiels ist von Stranitzky bis Ferdinand Raimund, ja noch bis in Nestroys „Lumpazivagabundus” einer ihrer wesentlichen Grund-Räume gewesen. Der Mensch, ob er nun Tamino oder Flottwell heißen mag, torkelt in ihm als Spielball fremdartiger und metaphysischer Mächte herum, versucht, gegen Schicksal und Vorbestimmung, ein eigener zu werden. Da mag im Verlauf schon so manches brüchig und verquer erscheinen. Aber – noch einmal Reinhard Urbach – die Wiener Komödie „hat einen soziologischen Sinn, sie beschreibt Schwierigkeiten des Zusammenlebens. Dem wird formal entsprochen. Das klassizistische Drama formuliert den Widerspruch als Einheit. In der Wiener Komödie bleibt der Widerspruch auch formal bestehen.”
Im engen Bretterhaus den ganzen Kosmos auszuschreiten, die Bühne als teatrum mundi vorzuführen, die ihre Weite in der Illusion der gesamten Bühnenmaschinerie findet: all das entnimmt das Wiener Volkstheater dem höfischen und geistlichen Spiel- Raum. Was alles wir in den Szenenanweisungen zur „Zauberflöte” an Kulissenbeschreibungen, an „wunderbaren” und „zauberhaften” Verwandlungen angemerkt sehen, führt uns über eine ausgeprägte Volkstheatertradition („Die Ausstattungsrevuen rund um den wienerischen Bernardon machen den Erdball zum Spielplatz” [Urbach]) zurück zu den bühnentechnischen Errungenschaften des Barock- und Jesuitendramas.
Seit 1712 also gab es mit Stranitzky und seiner Truppe das Kärntnertor-Theater, Karl Marinelli eröffnete 1781 das Theater in der Leopoldstadt, Christian Roßbach 1787 das Theater im Starhembergschen Freihause auf der Wieden, welches Emanuel Schikaneder nach dem Abbruch 1801 als Theater an der Wien wiedererrichten ließ, und ein Teil der Schikanederschen Gesellschaft hatte 1788 das Theater in der Josefstadt gegründet. Zählt man auch private Liebhabertheater dazu, so scheint es im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts – abseits dem 1742 eröffneten Burgtheater, das 1776 von Joseph II. zum k.k. Hof- und Nationaltheater „ernannt” wurde – bis zu achtzig Theater gegeben haben.
War ehedem im barock-höfischen Theaterleben das Bürgertum ausgeschlossen, nimmt neben ihm der Adel nun sehr wohl Platz in den Häusern der Vorstadt. Im Gegensatz zur Erhabenheit des Regeldramas finden sich dort nun alle Stände auf der Bühne. Und es finden sich alle Stände im Publikum. Zwar waren die Eintrittspreise im Verhältnis zu den Löhnen immer noch so hoch, dass Arbeiter und kleine Angestellte sich wohl keinen regelmäßigen Theaterbesuch leisten konnten, aber dennoch war die Kluft zwischen „Volk” und Adel im deutschen Sprachraum wohl nirgendwo geringer als in der Kaiserstadt Wien. Und Joseph II., so erzählt man sich, soll selbst den Kasperl nachgeahmt haben: „Nun, habe ich die Arie so vorgetragen wie der Kasperl?” – „Eure Majestät sind der leibhaftige Kasperl!” ...
Doch bei aller Unterhaltung, bei allem Amüsement der Theaterabende in der Vorstadt: die Besucher waren durchaus gefordert. Immer öfter, schon bei Schikaneder, stehen Parodien auf dem Programm der abendlichen Vorführungen; und eine Parodie macht nur Sinn (und lässt sich auf Dauer nur gut verkaufen), wenn sie auch verstanden wird, die Vorlage also mehr oder weniger vertraut ist. Das sind zumeist die großen Mythen des klassischen Altertums oder die Theater- und Romanerfolge des Tages, und es ist zu vermuten, dass jenes mit einem leicht „plebeijischen” Hauch angesehene Publikum des Wiener Volkstheaters durch ständige Schauspielbesuche und Kenntnis mythologischer Darstellungen ein sehr wohl gebildetes war. – Auch wenn die „Zauberflöte” keine Parodie ist, sie verwendet doch wesentliche Elemente damaliger Lese-Ereignisse: Christoph Martin Wielands Sammlung „Dschinnistan oder Auserlesene Feen- und Geistermärchen” oder der von Matthias Claudius ins Deutsche übertragene Bildungsroman „Sethos” des Abbé Jean Terrasson waren vielleicht nicht jedem im Eizelnen bekannt, aber ‚man kannte' sie eben.
So ist und bleibt „Die Zauberflöte” in jeder Hinsicht ein wesentlicher Bestandteil des Wiener Volkstheaters. Nicht nur weil sie ‚unterhält', sondern weil Fabel und Musik den Zusehern und -hörern auf unterschiedlichster Art und Weise bekannt waren und sind; weil sie, in all ihrer Heterogenität, menschlich-allzumenschliche Erfahrungen und Sehnsüchte auf der Bühne durch all ihre Figuren konkret werden lässt; weil sie Theater ist, nicht Ideendrama, nicht Bühnenweihfestspiel.
[614] Der Beitrag erschien anlässlich Harry Kupfers Inszenierung von Mozarts „Zauberflöte” am Salzburger Landestheater (Premiere am 21. Jänner 2000 im Rahmen der Mozartwoche) im Programmheft zur Produktion.