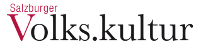

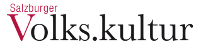

Begibt man sich heute auf (Urlaubs-)Reisen, dann ist die Begegnung mit dem „Erlebnis” oder dem „Abenteuer” allgegenwärtig. Der Weg zum Urlaubsort und die Straßen im Urlaubsort sind in der Regel flankiert von den Handzetteln der Agenturen, die besondere Erlebnisse offerierten. Vor einigen Monaten – zum Beispiel – in Spittal an der Drau im Kärntner Oberland. Auf der Homepage der Stadt Spittal an der Drau war einleitend zu lesen: „Die rund 16.000 Einwohner zählende Komödienstadt Spittal an der Drau im Kärntner Oberland versteht es trefflich, lebendige Tradition mit kulturbewußter Gegenwart zu verknüpfen. Nicht umsonst präsentiert sich die Metropole Oberkärntens zwischen Kultur und Natur als wahres Erlebnis für Geist und Körper. Kulturelles Bewußtsein, lebendige Tradition und ein Hauch südländische Gelassenheit – das sind die Wesenszüge, die unsere ‚kleine historische Stadt' so lebenswert machen.”
Das reale Spittal entspricht durchaus den virtuellen Verheißungen: in der Bahnhofshalle fand ich im Sommer 2001 das „Erlebnisprogramm” der Kärntner Landesausstellung „Schauplatz Mittelalter” in Friesach mit Ritterturnieren und Burghofspielen (und der Verlosung eines VW Golf und eines Fertighauses); des Weiteren ein Faltblatt, das – gesponsert von Amnesty International – zum Erlebnisbesuch des Foltermuseums im Rittersaal der Burg Sommeregg einlud („Werde Zeuge einer Hexenverbrennung, sehe Folterungen in Theresianischen Verliesen”); oder der Folder „Erlebniswelt Nockalmstrasse” der Nationalparkverwaltung, der ein „Erlebnisprogramm” mit Murmeltierbegegnung und Zirbenwaldbesichtigung ankündigte. Hier wie dort geht es, so versprechen die Etiketten der Marketingexperten, um Erlebnisse, um außergewöhnliche gefühlsanregende Erfahrungen – und: bei ehrlicher Betrachtung, auch in der Volkskunde (wie in den Kulturwissenschaften überhaupt), geht es letztlich um kaum etwas anderes: ein Vortrag, ein Buch, eine Ausstellung werden besonders dann von der Öffentlichkeit wahrgenommen, wenn den potenziellen Rezipienten damit ein „Aha-Erlebnis” ins Haus steht. Und zudem ist die Volkskunde nach wie vor dann von der Öffentlichkeit gefragt, wenn es um Spannung versprechende, volkskulturelle Erlebnispotenziale geht, die vor allem von den medialen Häppchenverkäufern nachgefragt werden: um die Einschätzung von Hexenprozessen, die Verortung von Halloween-Phänomenen, die Taxierung des Wahrheitsgehalts moderner Sagen, die biografischen Erzählungen von uralten Almbäuerinnen etc.
Dieser Beitrag thematisiert einige Verbindungslinien zwischen wissenschaftlicher und ökonomisch-kommerzieller Alltagsbeschreibung am Beispiel von aktuellen, kulturellen Phänomenen, denen Erlebnischarakter zugewiesen wird. Dabei rückt die „Erlebniswelt Volkskultur” in den Fokus der Betrachtung, denn insbesondere hier sind wir involviert: die Volkskunde als Schmiede des Produkts Volkskultur, als kompetente Stofflieferantin für das, was heute nicht mehr nur in kulturhistorischen Ausstellungen, sondern etwa auch in der Betriebwirtschaftslehre im Rahmen des „Regiomarketings” oder des „Trendmarketings” behandelt wird. Begleitet wird diese Orientierung von sich rapide ausbreitenden Erlebnisinstitutionen, die mit gezielter ökonomischer Strategie die so genannten „Erlebniswelten” planmäßig, nahezu industriell, produzieren. Dabei scheinen die Formate der Erlebniswelten so vielfältig wie ihre Orte und so „volkskulturell” wie möglich zu sein: Event-Cooking, Erlebnisadvent, Event-Shopping, Erlebnis-Biking, die Liste ließe sich nach weiterem Belieben vielzeilig fortsetzen.
Aus der Omnilokalität des Erlebnisses ergibt sich die Schwierigkeit, im Alltag scharf zwischen gewohnter Welt und Erlebniswelt zu trennen. Wo fängt ein Erlebnis an, wo hört es auf? Zu untersuchen wäre somit auch, ob die anderen Gefühle, die uns Eventmanagement oder Eventmarketing vermitteln wollen, tatsächlich als so anders wahrnehmbar sind: Fühle ich mich wie im Mittelalter, wenn ich das Foltermuseum der Burg Sommeregg besuche? Fühle ich mich wie in Griechenland, wenn ich Gyros mit Metaxasauce koche? Fühle ich mich wie in den Alpen, wenn ich im 640 Meter langen Alpincenter in Bottrop (Ruhrgebiet) eine Schiabfahrt unter einem Hallendach genieße?
Für die kulturwissenschaftliche Analyse stellt sich dementsprechend das Problem, ob es überhaupt möglich ist, mit Begriffen wie „Erlebnisgesellschaft”, „Erlebnisindustrie” oder „Erlebniswelt” wesentliche Phänomene unserer Zeit zu charakterisieren. Provokanter gefragt: Fallen wir mit unseren Bewertungen nicht permanent auf die immer neuen Etiketten der Freizeit- und Unterhaltungsinstitutionen herein? Jedenfalls scheint es bei den gegenwärtigen gesellschaftlichen Tendenzen um handfeste Diskursansprüche zu gehen, um das Agieren einer wirkmächtigen Branche, die darauf zielt, mit der systematischen, sprachlichen Umwidmung von banalen Alltagssituationen erst eine andere Gefühlswelt zu schaffen. Sind wir also dabei, eine „Labelling-Gesellschaft” zu installieren, oder leben wir sogar mittendrin? Und ist es nicht eher das Spiel mit den Worten und mit den alltäglichen Versatzstücken, dass das Vergnügen der Menschen auslöst?
Der Beitrag beginnt, diesen Fragen folgend, mit einer Rückschau auf eine kulturwissenschaftliche Begriffsinnovation, die Anfang der 1990er Jahre einsetzte, und die vielleicht sogar ein wenig katalytische Wirkung auf die Erlebnisorientierung unserer Zeit hatte: die Definition der Erlebnisgesellschaft – und: die damit einhergehende inflationäre Verwendung des Begriffs „Erlebniswelt” in unterschiedlichsten Varianten und Kontexten.
Ende der 1980er Jahre führte ich eine Untersuchung zur Genese und zur kulturellen Bedeutung des – damals erstmals boomenden – (kommerziellen) Erlebnis- und Abenteuertourismus durch.[3371] Dabei ließen sich einige Beobachtungen im Kontext dieses relativ jungen touristischen Phänomens machen. Deutlich zu registrieren war eine zunehmende, ästhetisch besetzte „Verwilderung” im Alltagsleben: Rauchende Männer wurden zum Inbegriff von Unabhängigkeit, junge wie ältere Menschen trugen Rucksäcke anstelle von Akten- oder Einkaufstaschen, auf den städtischen Straßen wurden Offroadfahrzeuge populär und repräsentierten die „wild side of life” (und man sprach vom Straßendschungel als Verkehrsproblem); in jedem größeren Ort öffneten Wander- und Sportgeschäfte, die sich fortan als „Outdoorläden” bezeichneten; in gutbürgerlichen Gaststätten standen plötzlich „Holzfällersteaks” auf der Speisekarte, und in Dänemark eröffnete der erste Center-Park Europas im Tropen-Design, Lalandia, der bis heute in Mitteleuropa viele Nachahmer fand.[3372]
Die Gestaltung der Freizeit geriet in den 1980er Jahren offensichtlich mehr und mehr in den Fokus kollektiver wie individueller Lebensentwürfe und Lebensinteressen. Auffällig war, dass für immer weniger Menschen die Kategorie „Beruf” das Selbstwertgefühl dominierte (und somit die soziale Position definierte) und dass für immer mehr Menschen die Erfahrung des Außergewöhnlichen – in der erwerbsfreien Zeit – soziale Relevanz bekam: Abenteuerreisen bedeutete „Erlebnis leben” in potenzierter Form, verhieß die verdichtete und gesellschaftlich hoch geschätzte Erfahrung des kulturellen Grenzübertritts vor allem in entlegenen Regionen Asiens, Afrikas und Amerikas, aber auch in heimischen Gefilden.
Im Unterschied zum damals bereits gebräuchlichen, soziologischen Begriff der „Freizeitgesellschaft”, der eine allgemeine Dominanz der arbeitsfreien Zeit gegenüber der Erwerbszeit suggerierte, fand ich es passender, diese soziale Formation als „Erlebnisgesellschaft” zu bezeichnen. Erlebnisgesellschaft deshalb, weil die mentale und gefühlsgerichtete Grenzerfahrung von immer größerer Bedeutung für das soziale und kulturelle Kapital des modernen Menschen zu werden schien,[3373] und Erlebnisgesellschaft auch, weil sich aus dem Begriff Freizeitgesellschaft eine Möglichkeit der Zeitdisposition ohne Zeitzwänge ableiten ließ. Das ist ja bekanntlich nicht der Fall, wie uns unter anderem jene Urlaubshektik zeigt, die wir in regelmäßigen Abständen zu Ferienbeginn auf Autobahnen und in den Abfertigungshallen der Flughäfen beobachten können. Auch in der Freizeit sind wir rigiden Zeitzwängen unterworfen; diese Zeitzwänge dienen im Urlaub dazu, ein maximales Potenzial an Erlebnissen zu realisieren. Sogar der Stillstand im Stau wird – so sagen die Tourismuspsychologen – immer wieder als besonders außergewöhnliches Urlaubsereignis vermittelt. Und jeder kennt sie: die Grenzerfahrungs-Geschichten von der „Erlebniswelt Autobahn”, als man in einer hundert Kilometer langen Fahrzeugschlange bei vierzig Grad Celsius Hitze sein Spiegelei auf der Kühlerhaube braten konnte oder als der ADAC[3374] bei zwanzig Grad Celsius Kälte die Wärmedecken und den heißen Tee vorbeibrachte.
Hermeneutisch ableiten ließ sich das Konzept Erlebnisgesellschaft aus den zivilisationstheoretischen Modellen von Norbert Elias: Die touristischen Sehnsüchte nach Wildheit, Ruhe, Einfachheit und Unkultiviertheit interpretierte ich historisch – als Reaktionen auf zunehmende Selbstzwänge, die mit der Etablierung bürgerlicher Kulturmuster wirkmächtig wurden. Die Umsetzung der Sehnsüchte („raus aus dem Alltag”) geschah Ende der 1980er Jahre (und geschieht auch noch heute) vor allem in räumlich und zeitlich limitierten und ästhetisierten Erlebniswelten, mit Hilfe einer systematisch arbeitenden Erlebnisindustrie, die darauf angelegt war (und ist), außergewöhnliche Erfahrungen als standardisiertes Programm zu produzieren. Das Produkt Erlebnis wird als vorwiegend mentales beziehungsweise gefühlsmäßiges wahrgenommen: Die Grenzerfahrungen erfolgen mit hoher physischer Distanz, mit allen Leibes-Versicherungen, die ein Reiseveranstalter oder ein Reiseausrüster bieten kann, und mit allen zivilisatorischen Beigaben, die für das eigene Wohlbefinden vonnöten sind. So ist im zivilisierten Abenteuer nicht einmal das durch Anstrengungen und Ängste motivierte Schwitzen tolerabel: Thermounterwäsche und Goretex-Technologien schützen uns vor unangenehmen körpereigenen Ausdünstungen und schützen uns gleichzeitig vor der Nässe der Natur.
Die Deklarierung der Erlebnisgesellschaft erfolgte aus einer Analyse und Kontextualisierung des Abenteuertourismus. Zwei Jahre später präsentierte der Bamberger Kultursoziologe Gerhard Schulze das theoretische Modell der Erlebnisgesellschaft, das auf einer umfassenden empirisch-quantifizierenden Untersuchung in der Stadt Nürnberg fußte.[3375]
Nach Schulze ist die zunehmende Erlebnisorientierung eine Folge des Übergangs von der Knappheits- zur Überflussgesellschaft. Er geht davon aus, dass unterschiedlichste individualisierte Formen des physischen und psychischen Genusses das soziale Leben im ausgehenden 20. Jahrhundert dominieren. Es reicht nun nicht mehr – wie noch in der durch Arbeit und Normenerfüllung bestimmten Welt der Nachkriegsjahrzehnte – sich anerkannte materielle Wünsche zu erfüllen und diese nach Außen hin zu repräsentieren. Wichtig wird zunehmend die Wirkung, welche die Konsumwelt auf das Innenleben des einzelnen Menschen ausübt.
Permanent wird der spätmoderne Mensch dazu veranlasst – aus einem weiten Spektrum konsumtiver Möglichkeiten – Entscheidungen zu treffen, die darauf zielen, ein möglichst selbsterfülltes, ein sich lohnendes Leben zu führen: Erlebnisrationalität, nennt Schulze diese Haltung.[3376] Der Soziologe hat seit 1992 seine Theorie der Erlebnisgesellschaft fortgeführt; 1999 veröffentlichte er das Buch „Kulissen des Glücks. Streifzüge durch die Eventkultur”.[3377] Darin werden die erlebnisrationalen Entwicklungen der 1990er Jahre mit Ausblicken ins neue Jahrtausend diskutiert.
Als „Lusttechnik” definiert Schulze jene Form von Produktion, die für die Erlebnisgesellschaft charakteristisch ist: Diese Technik manifestiert sich besonders auffällig im Bereich der öffentlich gewordenen Sexualität, sie ist individuell ausgerichtet, sie erfüllt Ansprüche aller Art: Intimschmuck und Potenzpille dienen wie der Möbelhausbesuch, der Volkstanzabend oder das Autofahren zur Erzeugung „besserer Erlebnisse” und erfüllen die sinnstiftenden Leitbilder der Erlebnisrationalität. „Die erlebnisrationale Sichtweise deutet die ganze Welt als Selbstbefriedigungsgerät”, so Schulze.[3378] Er bezeichnet das Dasein in der späten Moderne als „Projekt des schönen Lebens”, das nur durch „die letzte noch mögliche Sünde [...], die Langeweile, misslingen kann”.[3379] Schulze verdeutlicht in seinen Ausführungen gleichzeitig, dass in den unzähligen Bemühungen unserer Kultur, faszinierend zu sein, in dem Bestreben, sich allzeit und allerorten persönliches irdisches Glück zu verschaffen, der Keim genau zu dieser letzten möglichen Sünde – eben der Langeweile – liege.
Nichts erscheint demnach so wenig erfüllend wie ein Lebenslauf, in dem nichts passiert. Um einer unzureichenden Lebensbilanz vorzubeugen, gerät die eigene Vergangenheit zunehmend zum Stoff einer Erlebniserzählung, ein Vorgang, auf den die volkskundliche Biografieforschung mehrfach direkt oder indirekt hingewiesen hat.[3380] Die erlebnisrationalen Erzählmuster können dabei zum Beispiel
persönliche Traditionen als außerordentliche Erfahrungen vermitteln (also etwa den unvergesslichen Geschmack von Großmutters Apfelkuchen thematisieren),
sie können die individuelle Teilhabe am großen Weltgeschehen aufgreifen (ich als Mauerspecht anlässlich der Wiedervereinigung oder ich als Tourist in Nelson Mandelas Südafrika),
oder sie können individualisierte, retrospektive Erinnerungen an jene Alltagserfahrungen sein, die heute immer stärker in parodistischen oder „kultigen” Retrotrends münden: Ich war dabei als jene Schlaghosen und der Schlager im Original en vogue waren, die heute Guildo Horn reproduziert.
Eine zentrale kulturelle Kompetenz der Teilhaber der Erlebnisgesellschaft ist die „folkloristische Formensouveränität”, Schulze meint damit das Sich-Auskennen im „Archiv der Ereignismuster”, das ständig neu vermischt und aktualisiert wird: etwa durch die Verpackungskunst von Christo, die Plastikgeige von Vanessa Mae, durch die Love-Parade in Berlin, die Choreografie von Boy groups oder durch die Trinkrituale am Strand von El Arenal, am so genannten Ballermann auf Mallorca, die dann in oberbayerischen Stadeldiscos neu aufgelegt werden.[3381] Die Ereignisfolklore wird zum eigenen Symbolschema, und die Elemente dieser Folklore verweisen nicht auf einen moralischen Kern, sondern einzig auf sich selbst. Dementsprechend unspezifisch bewertet werden die Events durch ihre Besucher oder Nutzer: Wie war's gestern Abend? Interessant, super, endgeil oder einfach nur: ganz nett.
Die omnipräsente „Gier auf Erlebnisse” ist historisch gesehen nicht einmalig,[3382] neu sind nach Schulze jedoch die subjektzentrierten Motive der Erlebnisrationalität. Den allermeisten Zuhörern heute gehe es bei der Aufführung eines Weihnachtsoratoriums ausschließlich um das persönliche Wohlempfinden. Über dieses persönliche Moment hinaus erfüllt das Oratorium keine weiteren Funktionen: kein Bezug zum Jenseitigen, keine religiöse Einbindung, wie es noch im 19. Jahrhundert üblich war.[3383] Die Eliminierung des jenseitigen Lebens aus dem Alltagsdenken, darauf hat Arthur Imhof hingewiesen, führt letztlich dazu, die diesseitige Existenz so lang, so angenehm und so erlebnisreich wie möglich zu gestalten. Biotechnologie, Wellness-Bewegung und plastische Chirurgie zielen in genau diese Richtung.[3384]
Obwohl diese Beschreibungen an jene Auflösungsrhetoriken erinnern, die in der Soziologie und gleichermaßen in der Volkskunde immer wieder aufkochen, wenn alte Kulturmuster durch neue verdrängt oder wenn lokale durch globale Muster ersetzt werden, kann man Schulze nicht als Kulturkritiker einordnen. Er propagiert und prognostiziert keine Gegenbewegung, keine Umkehr in diesem Prozess. Vielmehr geht er davon aus, dass wir unwiderruflich angekommen sind – in der Erlebnisgesellschaft, und dass es nun darum gehe, uns in dieser Gesellschaft konstruktiv einzurichten.[3385]
Schulzes Diagnosen erweisen sich als zielsicher, besonders dann, wenn man jene Alltagsphänomene verfolgt, denen der Begriff oder das Etikett „Erlebnis” oder „Erlebniswelt” zugedacht wird. Der ideale erlebnisorientierte Lebenslauf beginnt bereits in der pränatalen Phase. Das populärwissenschaftliche Magazin „Geo” vom Juli 2001 steht unter der Überschrift „Erlebniswelt Mutterleib”. Es dokumentiert mit zahlreichen Fotos den „Erlebnisraum Mutterleib”, der die Existenz des Fötus bis an sein Lebensende im hohen Alter präge. Der Artikel betont mehrfach, dass sich die Auffassung der pränatalen Medizin in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend geändert habe: der Fötus sei kein „gefühlloser Zellklumpen”, wie früher angenommen, sondern ein höchst wahrnehmungsfähiges, gefühlempfindliches Wesen, das besonders stark den Einflüssen von Seiten der Mütter während der Schwangerschaft ausgesetzt sei. Dementsprechend ist in den USA seit einigen Jahren das „Föten- Training” angesagt, sozusagen als Auftakt zum Projekt des „lebenslangen Lernens”: „Werdende Mütter schnallen sich teure Kassettenrecorder um den Bauch, beschallen ihre Kinder mit Bach und Beethoven oder lesen ihm über ein Spezial-Megafon Reime und Märchen vor”.[3386] Nicht uninteressant ist, dass im Geo-Artikel diesem Wissen eine historische Tiefe verliehen wird: Bis ins 18. Jahrhundert hinein existierten in Europa Vorstellungen, die belegen, dass heftige Erlebnisse der Mutter Folgen für das Ungeborene haben können: „[V]ersieht sie sich im Schreck an einem Hasen, so bekommt das Kind ein zitterndes Kinn oder eine Hasenscharte”. Quelle dieser Geo- Information ist das „Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens”.[3387]
Die frühestkindliche Erlebnisorientierung ist nicht nur eine US-amerikanische Tendenz. Klaus Hipp, Deutschlands bekanntester Babynahrungshersteller, lässt auf einem Schwangerschaftskalender, auf dessen Cover eine entspannte werdende Mutter im goldfarbenen Pyjama verweilt, einen imaginären Fötus zu Wort kommen: „Meine ersten Wochen mit Mama, ein unvergessliches Erlebnis.” Diesem pränatalen Erlebnis folgt schließlich das natale, das – glauben wir den Entwicklungspsychologen – für Kind und Mutter elementar wichtig ist.[3388] Kommt es, wie im Falle eines Kaiserschnitts, nicht zur „eigentlichen” Geburtserfahrung, dann helfen ersatzweise, therapeutische Maßnahmen, um dieses entgangene Erlebnis nachzuholen (etwa die so genannte Cranio-Sacral-Therapie, die für Mutter und Säugling angeboten wird).
Nur wenige Jahre nach der Geburt (oder der Therapie) erwartet das Kind im Kindergarten die so genannte Erlebnispädagogik (bei der es darum geht, Kindern systematisch Ersterfahrungen zu vermitteln), im Schulalter locken Erlebnisferien mit den Eltern. Mit ihnen zusammen lernt man, zum Beispiel im Mittelgebirgsurlaub, Goldwaschen oder Töpfern oder besucht eine der zahlreichen Erlebnisparks, die mit immer neuen Attraktionen, die Gefühlswelt ihrer Kunden stets aufs Neue herausfordern. Das fortgeschrittene Jugendalter wird vom Eventmanagement der Konzert- oder Liebesparadenveranstalter begleitet. Sofern man während dieser Events beim Drogenhandel auffliegt und eine Jugendgefängnisstrafe erhält, kann man in den Genuss einer anderen Variante Erlebnispädagogik kommen: Erlebnis-Segeltörns mit jugendlichen Strafgefangenen sind eine bewährte Methode der Sozialisationstherapie.
Im etablierten, gut situierten Alter locken vor allem das Erlebnis-Shopping, das nicht nur in den repräsentativen Galerien der Großstädte inszeniert wird, sondern auch in den Einkaufszentren kleinerer Vororte. Ein Obi-Baumarkt im Münchener Umland wirbt zu Beginn der Frühlingszeit mit dem Slogan: „Mach Dir die Welt, wie sie Dir gefällt” (gerade so, als hätte der Werbedesigner die Individualisierungsszenarien von Gerhard Schulze für seine Zwecke transformiert). Bis ins höhere Alter stellt der Bereich des materiellen Konsums eine sehr wichtige Erlebnisebene dar. Besonders Einrichtungsgegenstände scheinen dem Prinzip der Erlebnisrationalität zu gehorchen. Regelmäßig liegen den Tageszeitungen Werbebeilagen von Möbelhäusern bei, die sich als „Erlebniswelt” darstellen. Vor Ort präsentieren sich diese Möbelhäuser tatsächlich jeweils als geschlossener „Kosmos”, in dem – würde es sich nicht um ein Möbelhaus handeln – mit ein paar wenigen Installationsarbeiten tatsächlich zu leben wäre, ohne diese Welt jemals verlassen zu müssen.
Im „Herbst des Lebens”, dem Pensions- oder Rentenalter, sind es vor allem die Aktivsportarten, die Kreativbeschäftigungen und die kulinarischen Reiseerfahrungen, denen sinnhafte Erlebnisträchtigkeit zugeschrieben wird: Reiten und Wandern, Radfahren und Wellness, Weinseminare, abermals Töpfern oder asiatische Kochkurse. Und schließlich steht sogar das Lebensende – das Sterben – im erlebnisrationalen Diskurs. Denn gesellschaftlich immer stärker unter Kritik gerät das „anonyme”, technisch begeleitete Sterben in den geriatrischen Stationen der Krankenhäuser. Neuere, immer stärker nachgefragte Modelle setzen das bewusste Erleben des Sterbens in Hospizen dagegen.[3389] Dieses bewusste Erleben betrifft nicht nur die Sterbenden selbst, sondern auch deren Angehörige und Freunde, die gefühlsadäquat das Lebensende begleiten und Abschied nehmen können.
Im Gleichschritt mit diesen an den Lebenslauf gebundenen Formen scheinen sich gewöhnliche Erfahrung und Erlebnis-Erfahrung im Alltagsleben stärker zu nivellieren. So sind Arbeit- und Erlebniswelt nicht länger als Gegensätze aufzufassen, sondern miteinander verwoben: Metaphern aus dem Wortfeld Abenteuer, Reise, Expedition begleiten den neuen Helden der Arbeitswelt: den Existenzgründer: „Für einen angehenden Unternehmer bedeutet die Gründung eines Unternehmens ein persönliches und finanziell befriedigendes Abenteuer”, das erste Geschäftsjahr wird zur spannendsten Zeit des Lebens, heißt es im Ratgeber „Survival für Existenzgründer” aus dem Jahr 1992.[3390] Der Idealtyp der Arbeitswelt ist längst nicht mehr der fleißige und zielstrebige Kommando empfangende Sachbearbeiter der 1960er oder 1970er Jahre, sondern der flexible, mobilitätsorientierte, kreative und entscheidungsfreudige Manager. Survival camps, in denen seit Mitte der 1980er Jahre diese Tugenden vermittelt werden, sind weit verbreitete Einrichtungen. Der Zehnkämpfer Kurt Bendlin war im deutschsprachigen Raum der Pionier dieser Bewegung.
Ein ähnliches Projekt, das auf die Symbiose von Arbeit und Erlebnis verweist, wurde 1991 von der Siemens AG ins Leben gerufen. Es heißt „Wirtschaftsvisionen”. Mädchen im Alter von 16 bis 18 Jahren sollen dabei unter künstlerischer Begleitung in „Technik- Abenteuer-Camps” männliche Erfahrungsdomänen erobern. Im Prospekt zum Projekt ist zu lesen: „Mädchen und junge Frauen erfahren hier: ‚Mensch ich kann das!' Einen Walkman-Verstärker bauen, einen Kletterfelsen dank eigener Stärke und mit Hilfe des Teams bezwingen, eine Website programmieren”.[3391] Und weiter: „Der Computer scheint – auch für Mädchen – ein gutes Objekt zu sein, um die Erfahrung von Subjekthaftigkeit, Leistungslust und Sachkompetenz zu machen”.[3392]
Lust und Kompetenz in einem Atemzug – nach dem Klettern gleich zum Programmieren, John Urrys These von der totalen Touristifizierung der Welt, unabhängig von Raum und Zeit – steht wohl im Einklang mit dem erlebnisrationalen Paradigma. Müssen wir also wirklich nur noch lernen, unser Dasein mit den Erlebnissen zu arrondieren und zu arrangieren: selbstbezogen, lebenslang und allerorten? Oder aber sollen oder können wir einen Ausweg aus der Kulissenrealität finden, zurück zu den Wurzeln originärer Erfahrung? Wie ist die Haltung der Menschen, die als Akteure die Erlebniswelten schaffen und nutzen?
Ein empirischer Ausflug in eine ganz neu errichtete Erlebniswelt gab mir zu denken: das schon erwähnte Alpin-Center in Bottrop, Ruhrgebiet. Perfekt inszeniert: Es handelt sich um eine grüne Blechhalle, die eine 640 Meter lange, künstlich beschneite Schi- und Snowboard-Abfahrt, ausgehend vom „Gipfel”, einer ehemaligen Kohlenhalde, überdeckt. Hier bestätigt sich die Erlebnisrationalität besonders auffällig. Die Werbebroschüre schreibt vom „Fit- und Funerlebnis der Superlative” mit garantiertem hundertprozentigen Wintersportvergnügen das ganze Jahr über, mit Erlebnis-Gastronomie für individuelle Bedürfnisse. Das „alpine Ambiente” der Gastronomie ist für dreihundert Gäste konzipiert: ein „lustvoller Rahmen” findet sich im „Hasenstall”, dem „Kaminzimmer”, in der „Pfand'ler Alm” und der „Tenne”. Investoren und Sponsoren sind bekannte Schirennläufer (wie zum Beispiel Marc Giradelli) sowie die Tiroler Gletscherregion Kaunertal, die großflächig Werbefolien ausgerollt hat.
Und was geschah nun dort am Karsamstag 2001, einem für die meisten arbeitsfreien Tag, dem man sicherlich einen hohen Erlebniswert zuschreiben würde? Vielleicht zwei Dutzend Wintersportanhänger fuhren am Vormittag gemächlich einen flachen Hang hinab, zeitweise beäugt von ebenso vielen biertrinkenden Hasenstallbesuchern, die ansonsten nichts anderes taten als die Gäste in der Bottroper Eckkneipe einen Kilometer entfernt. Das Ambiente war geprägt vom vielerorts beliebten, quasi- freilichtmusealen Inventar: Dreschflegel, Flachshechel, Holzschlitten und unzählige historische Fotografien mit Wintersportlern an den Wänden. Außergewöhnliche Gefühle waren aus den Gesprächen der Gastronomiegäste nicht abzuleiten, einige wenige passten sich allerdings in ihrem Habitus der vorgegebenen Ästhetik an: im Schneeanzug einen Germknödel essen, mitten auf der Kohlenhalde. Aber superlative Sinnenfreuden? Auch beim ethnografischen Gang auf die Toilette wurde ich nicht fündig: trotz alpiner Ästhetik – das Pissoir ist mit einer Plexiglasscheibe versehen, hinter der künstliche Grasflecken angebracht sind – kein staunendes oder erregtes Verweilen der Gäste.
Was dieses Beispiel ausdrücken soll: die große Mehrzahl jener Erfahrungen, die mit Erlebnisräumen verbunden sind, lassen sich empirisch nicht ihrer Bezeichnung entsprechend als außergewöhnlich oder als sinnen- beziehungsweise gefühlsbetont kategorisieren: Die Besucher fühlen sich definitiv nicht wie in den Alpen, wenn sie die Bottroper Alpin-Center-Piste herunterfahren; sie fühlen sich ebenso wenig wie am Strand, wenn sie in der Diskothek Playa in Bochum tanzen, sie fühlen sich nicht annähernd wie in den Tropen, wenn sie in Center-Parks unter Palmen liegen, und sie fühlen sich nicht wie in Thailand, wenn sie ein thailändisches Restaurant in Deutschland besuchen, auch wenn es „landestypisch” eingerichtet ist. Und können Sie sich vorstellen, worin das innere Erlebnis besteht, wenn ich mich Samstag vormittags mit Hunderten von anderen Kunden in der Young-Design-Abteilung des Karstadt- Möbelhauses aufhalte und jene weißen Plastik-Gartenstühle ausprobiere, die mir vom Marketing als Wohnerlebnis angepriesen werden? Empirisch nur schwer überprüfbar ist demnach die Einschätzung Schulzes, dass mit diesen theatralischen Formen elementare Sehnsüchte, Wünsche und Fantasien und Szenarien verbunden sind, die das nach irdischem Glück suchende Innenleben des modernen Menschen erfüllen
Offensichtlich ist es eben nicht das inhaltliche Versprechen, sondern das souveräne, zum Teil auch ironische Spiel mit den folkloristischen Formen, das die Erlebniswelten trägt. Es ist der Spaß der Menschen daran, die umgebende Wirklichkeit zu gestalten und zu interpretieren – Kulissen sind allgegenwärtig, betont Schulze treffend.[3393] Erving Goffman hat bereits Ende der 1950er Jahre die theatralische Haltung beschrieben, mit der wir unsere alltäglichen Lebenswelten inszenieren. Er unterschied damals zwei konträre Positionen: einmal diejenigen, die in der „front region”, der Vorderbühne, agieren, also dort, wo die Vorstellung stattfindet (also etwa die Touristen und Kellner), und diejenigen, die in der „back region”, der Hinterbühne, tätig sind, dort wo die „Illusionen und Eindrücke offen entwickelt werden”,[3394] dort, wo die Kulissen erstellt werden, also etwa in der Küche eines Restaurants. Was uns von den 50er Jahren grundlegend unterscheidet, ist die Aufhebung der Grenzlinien zwischen Front- und Backregion. Spannend für die Touristen (oder die Besucher) ist das „making of” – also zu erfahren, wie etwas gemacht wird: Nichts ist bei jugendlichen Konzertbesuchern begehrter als eine Backstage-Karte, sie verschafft den Zutritt zum eigentlichen Leben der Stars, hier sieht man, was sich hinter dem Spiel verbirgt, obwohl man zugleich weiß, dass auch dieses Backstage nur gespielt wird. Und interessanterweise kreisten so manche Gespräche der Alpin-Center-Gäste genau um dieses making of: wie denn die Betreiber die Schi-Halle auf minus fünf Grad Celsius herunterkühlen, wie sie die Germknödel genauso hinkriegen wie im Kaunertal oder sogar besser, wo die Dekoration wohl herstammt und so weiter.
Zur Inszenierung gehört ganz wesentlich der sprachliche Umgang mit den Stoffen: mit Hilfe einen schier unendlich varianten- und ideenreichen Etikettierung alltäglicher Formen, mit ihrer sprachlichen Transformation in Erlebniswelten,[3395] entwickeln wir eine eigene kulturelle Technik gegen den „Horror vacui”, die Angst vor der Leere, vor dem Nichtstun und vor der befürchteten Langeweile. Einige statistische Zahlen geben Anlass zu dieser Schlussfolgerung: Die Erwerbsdauer der männlichen Bevölkerung in Deutschland hat sich seit 1960 von durchschnittlich netto 42 Jahre auf 25 Jahre im Jahr 2000 verkürzt, bei einer Lebenserwartung, die mit 77 Jahren um acht Jahre höher liegt als vor vier Jahrzehnten. Gehen wir von einem Acht-Stunden-Arbeitstag aus, dann sind wir heute weniger als ein Neuntel unserer Lebenszeit mit Erwerbsarbeit befasst.[3396] Was im übrigen nicht heißt, dass acht Neuntel des Lebens Freizeit sind, denn wir schlafen ja auch, gehen in die Schule, sind krank und Ähnliches. Jedenfalls aber verfügen wir historisch gesehen über ein extrem hohes Maß an Zeit, die wir selbst ausfüllen müssen.
Die Beschreibung eines Milieus als außergewöhnliche Erlebniswelt, die Umwidmung des gemeinen Radfahrens in „Adventure-Biking”, die Umbenennung des Skitourenlaufs in „Mountain-Attacking” (Prospekt „Winterfreunden im Salzburger Land” 2/2000), die Taufe eines Hallenbades zur „‚Aquapulco'-Vitalwelt” (in Bad Schallerbach/Gallspach in der österreichischen Ferienregion Innviertel-Hausruckwald) helfen, mit dieser Verfügungsmasse fertig zu werden. Die sprachliche Modernisierung verknüpft dabei häufig kulturelle Gegensatzpaare: der Wintersportverbund „Dolomiti Superski” wirbt 1997/98 im Ferienprospekt „Dolomiti snow high-lights. Bunte Ferien” mit „competition and tradition”, „past times and modern times”, mit „ice and ice cream”. Der Broschüre ist zu entnehmen: „Die beiden Wochenpakete ‚Fasching im Fassatal' bieten neben dem einmaligen Skierlebnis um den berühmten Sellastock auch Romantisches: ein Abendessen auf einer der typischen Hütten mit einem kleinen Ausflug im Motorschlitten. Zurück geht's dann stilecht mit der Rodel. Und damit das Feiern nicht zu kurz kommt, sind Besuche von vergnüglichen Faschingsumzügen und Maskenbällen vorgesehen. Und Sie werden sehen: die Ladiner verstehen es, zu feiern!”
Und woher nehmen wir die Kompetenz zur folkloristischen Formensouveränität, zum ironischen Umgang mit den Alltagssymbolen, zur Etikettierungskunst unserer Zeit? Rolf Lindner hat in den letzten Jahren in mehreren Studien auf die Funktion kulturwissenschaftlicher Beschreibungen in diesem Prozess hingewiesen.[3397] Kulturwissenschaftler, Kultursoziologen oder Volkskundler (dies können auch solche in journalistischen Berufen sein) kulturalisieren Alltagsphänomene durch ihre Art und Weise, Wirklichkeitsphänomene zu beschreiben. Auf die Formel von der Erlebnisgesellschaft gemünzt bedeutet dies: Die Lust an der Inszenierung des eigenen Lebens als immerwährendes Erlebnis fußt – nicht nur, aber auch – auf kulturwissenschaftlichen Vorgaben: Der alpine Hasenstall in Bottrop sieht so aus, weil die Teilhaber der Erlebnisgesellschaft heute wissen, wie eine alpine Almhütte aussieht, nicht zuletzt dank der detaillierten und zahlreichen Beschreibungen in volkskundlichen Fachbüchern und Ausstellungen oder auch in journalistischen Features.
Diese Kulturalisierung des Alltäglichen ist die instrumentelle Basis, Phänomene zum Kult, zum symbolbesetzten Kollektiverlebnis, werden zu lassen. Es sind die besonders dicht beschriebenen Szenen des Alltags, die besonders drehbuchgerecht aufgeführt werden: etwa die Figur des vulgären Massentouristen am vielzitierten Ballermann, der Strandpromenade von El Arenal auf Mallorca. Hier auf Mallorca – dies zeigten die Eindrücke während einer Studienexkursion des Münchener Volkskunde-Instituts im Sommer 2000 – wird die eigene Ethnografie kultiviert. Die Institutskamera, mit der zwei Studenten vor Ort unterwegs waren, löste bei den Touristen ein extrem medienadäquates Verhalten aus: sobald die Kamera auf der Strandpromenade in Aktion trat, begannen die Leute, Lieder anzustimmen oder rhythmisch in die Hände zu klatschen, einige konnten nicht umhin, sich vor der Kamera komplett zu entblößen. „Bin ich jetzt im Fernsehen?”, wurden wir immer wieder gefragt und niemand nahm uns ab, dass wir eigentlich „nur” Volkskundler (und nicht die Straßenreporter deutscher Privatfernsehsender) waren.
Erst die Beschreibung und Etikettierung durch die kommerzielle Erlebnisindustrie und durch die mediale und wissenschaftliche Tourismuskritik haben das sommerliche karnevaleske Leben an diesem Strandabschnitt zur außergewöhnlichen Erfahrung gemacht. Und zwar nicht nur zum Kult-Erlebnis für die direkt Beteiligten, sondern auch für all jene „anderen” Mallorca-Touristen, die vom „originären” Hinterland der Insel in Bussen anreisen, um der Aufführung „Massentourismus” und dessen making of beizuwohnen.
Am Ballermann ist daher auch ein spezifisches Phänomen der Erlebnisgesellschaft besonders klar fixiert: der Metatourismus, ein erlebnisbesetzter Vorgang bei dem Touristen beobachten, ob Tourismus drehbuchgerecht inszeniert wird. Und die Geschichte hat noch eine Vorgeschichte: als ich im Februar 2000 zur Exkursionsvorbereitung auf der Insel war, konnte ich festhalten, wie Rentnergruppen den in der Nebensaison verwaisten Strandkiosk „Ballermann 6” einnahmen und sich dort zum Sangriatrinken niederließen. Die gesamte Szenerie wurde fotografiert von spanischen Touristen, die interessiert daran schienen, wie die Deutschen ihre ‚heimischen' Trinkrituale durchführen. Touristen wie Mallorquinern wird zunehmend bewusst, dass die populäre Kultur Mallorcas nicht im vermeintlich ursprünglichen Outback stattfindet, sondern entlang der turbulenten Strandpromenaden Arenals.
[3372] [KöckCh 1990], S. 45ff.
[3373] [KöckCh 1990], S. 156f.; siehe auch: [KöckCh 1993a].
[3374] ADAC = Allgemeiner Deutscher Automobil-Club; Österreichisches Pendant: ÖAMTC – Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring-Club.
[3378] [SchulzeG 1999b], S. 35.
[3379] [SchulzeG 1999b], S. 39.
[3380] U.a. [LehmannA 1978].
[3381] Vgl. [SchulzeG 1999b], S. 71f.
[3382] Vgl. [Löfgren 1999b], S. 41–65.
[3383] [SchulzeG 1999b], S. 89f.
[3384] Vgl. [ImhofAE 1988], S. 68f.
[3385] [SchulzeG 1999b], S. 100f.
[3386] [Hardenberg 2001], hier S. 38.
[3387] [Hardenberg 2001], S. 42.
[3388] [Hardenberg 2001], S. 42.
[3390] [HesslerA 2001], S. 6. Vgl. das INNENLEBEN der Organisation.
[3391] [Ottmann 2001], hier S. 2.
[3392] [RitterM 2001], hier S. 3.
[3393] [SchulzeG 1999b], S. 11.
[3395] Vgl. [Gerndt 2001].
[3396] [Ederer/Schullar 1999], S. 60f.
[3397] [Lindner 2000]. Vgl. [KöckCh 2001b].