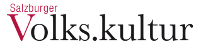

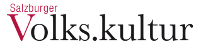

Zwar sind die Beweise spärlich und unsicher, doch es kann, ja es muss wohl so angefangen haben: In den Wärmeperioden nach der letzten Eiszeit drangen reitende Nomaden aus Asien mit ihren Rinder-, Schaf- und Ziegenherden bis nach Osteuropa, besonders ins heutige Ungarn vor, wo sie Verhältnisse antrafen, die denen ihres ursprünglichen Lebensraumes ähnlich waren. Ihre Kundschafter zogen weiter durch die Wälder und Auen des westlich anschließenden Berglandes und entdeckten schließlich weite Grasflächen oberhalb der Wälder. Nach und nach wurden Wege gefunden, auf denen die Einwanderer einigermaßen sicher mit ihrem ganzen Besitz diese neuen Gebiete erreichen konnten, und sie benannten diese Bergweiden mit den Worten „Alp” oder „Alb”.
Mit den Schneefällen des Herbstes hörte sich der Weidebetrieb auf, und man zog sich zurück in die Ebenen. Es kann aber nicht lange gedauert haben, bis man auch im oder nahe dem Bergland Gegenden mit milderem, trockenerem Klima und lockeren Wäldern vorfand, in denen man mit den Herden noch leidlich überwintern konnte. Man denke besonders an die „Mittelgebirge” Süd- und Nordtirols, an den Vinschgau, an Teile des Tiroler Oberlandes und an das angrenzende Graubünden.
In den folgenden Jahrtausenden kamen neue Zuwanderer aus dem Südosten und Süden (Illyrer, Ligurer, wohl auch Etrusker) auf die Bergweiden, deren Bezeichnung „Alpen” sie übernahmen. Mit ihnen kamen wohl auch Leute, die schon wussten, dass man aus gewissen Steinen Metalle schmelzen konnte: zuerst Kupfer (Mühlbach am Hochkönig, die Gegend um Kitzbühel u. a.), Zink, Zinn und Blei, dann auch Gold und Silber (Lungau, Schwaz in Tirol, vor allem aber Gastein und Rauris) und schließlich Eisen (z. B. in Kärnten und den Lungauer Nockbergen).
So kam es zu einer Zusammenarbeit und gegenseitigen Ergänzung von Bergweide und Bergbau: die einen erhielten immer bessere Werkzeuge und Gefäße, die anderen bekamen Milch, Butter, Käse und Fleisch. Man hatte längst gelernt, von der Milch den Rahm abzusondern und aus diesem Butter zu „schlagen” (die uralten „Stösselkübel” gibt es von den Pyrenäen bis nach Tibet) und durch Erwärmen von saurer, dicker Milch das Milcheiweiß in Form von Topfen, den man zu Graukäse ausreifen ließ, auszufällen. Eine andere Art der Käsebereitung entdeckte man (bereits im Zwischenstromland) dadurch, dass man Milch zum Gerinnen brachte, wenn man sie in Schläuche aus Kälber- oder Ziegenmägen einfüllte und so die Wirkung von Lab [Enzym im (Kälber)magen] ausnützte. Diese Möglichkeiten der Milchverarbeitung erlaubten es nun, die Milchprodukte auf Vorrat einzulagern, sie weiter fort zu transportieren für den Handel, der sich über die Berge hinweg schon allmählich entwickelte.
Weitere Fortschritte gab es bei der Holzbearbeitung. Während in den Hochlagen die notwendigen Bauten (und Zäune!) in Stein ausgeführt wurden, verwendete man im Waldbereich natürlich Holz. Statt des Ständerbaues der Pfahlbauten (in Laubwaldgebieten) baute man die ersten Hütten in den Nadelwäldern der Berge in Blockbau. Nach dem Vorbild der ersten Bauten auf den Almen errichtete man auch die ursprünglichen Gebäude in den Tallagen, wo man nun näher gelegene Winterquartiere schuf.
Durch die Entnahme von Brenn-, Bau- und Zeugholz entstanden in den Waldgebieten schon einigermaßen freie Flächen, auf denen außer der Frühjahrs- und Herbstweide auch das notwendige Heu für das Winterfutter gerupft und geschnitten (noch nicht gemäht!) werden konnte. Durch Viehverbiss und „Schwenden” (Ausreißen oder Abschneiden von Sträuchern und Jungbäumen) ließ man auch die Waldverjüngung kaum noch aufkommen. Die Einwanderer aus dem Süden betrieben schon einen gewissen Ackerbau, zu dem sie auf den trockenen Böden ihrer Siedlungsgebiete ihre „Arl” (einen Hakenpflug) verwendeten. Den Kelten, die sich ab etwa 500 v. Chr. unter anderem im Alpenvorland und im östlichen Teil der Ostalpen niederließen, wird die Erfindung des Pfluges zugeschrieben, mit dem sie die Schollen ihrer schwereren Böden wenden konnten.3
Klima und Vegetation des Berglandes, zusammen mit dem Stand der Wirtschaft (Bergbau auf Kupfer, Eisen, Salz, dazu Gewerbe und Handel) führten dazu, dass auch die Kelten die Alpwirtschaft übernahmen. Und als dann vor 2.000 Jahren die Römer, nicht nur aus strategischen Gründen, bis an die Donau vorrückten, waren für sie gerade drei Bergprodukte besonders interessant: norisches Eisen, Norikerpferde und Käse. Auch die Römer übernahmen das Wort „Alp” und dehnten den Begriff sogar auf das ganze Gebirge von Nizza bis Wien aus. Ihre „alpes” sind somit seither „die Alpen”, und ihre Straßenstation auf dem Radstädter Tauern hieß „in alpe”, also „auf (oder in) der Alm”.
Das Land östlich des Ziller und Inns übernahmen die Römer eher friedlich und machten es zur Provinz Noricum. Westlich dieser Grenze widersetzten sich aber die Räter [benannt nach den Rätischen Alpen] dem Einmarsch; sie wurden blutig unterworfen und als Provinz Rätien dem Reich eingegliedert. Mehr oder weniger freiwillig übernahm die ansässige Bevölkerung die römische Lebensweise und Rechtsordnung und vor allem die lateinische Sprache, die sich in abgewandelter Form in Graubünden, in den Dolomiten und in Friaul als Romanisch, Ladinisch oder Furlanisch erhalten hat. Gerade in diesen Sprachgebieten sind auch die ursprünglichen Formen der Alpwirtschaft bis heute anzutreffen. Das Römerreich wurde nach und nach geschwächt und schließlich von den Hunnen und einigen germanischen Völkern überrannt. Auf den Heerstraßen der Römer zogen nun Alemannen (vom Lech bis ins Schweizer Hochgebirge), Baiern und Südslawen (im nördlichen und südlichen Noricum) als neue Siedler in die Alpen. Auch sie alle fügten sich in die vorhandene und intakte Alpwirtschaft ein.
Mit der allmählich zunehmenden Bevölkerungsdichte setzte sich allerdings, besonders im bairischen Gebiet, die Rechtsauffassung durch, dass alles Land dem Landesherrn gehörte und dass dieser es erst aufteilte und seinen Untergebenen zur Nutzung überließ (Lehens- oder Feudalwesen). Allerdings mussten letztere dafür gewisse Dienste und vor allem Steuern leisten, von den Almbauern hauptsächlich in Form von Tieren und Milchprodukten, besonders Käse und Butterschmalz.
Bei all den kurz geschilderten Wanderbewegungen wäre übrigens noch zu fragen, ob die neu „Zugereisten” jeweils als Eroberer oder zuerst als „Gastarbeiter” in die Alpen kamen. Letzteres dürfte eher zutreffen, und das ist auch damit zu erklären, dass in mehreren Gegenden die schon ansässigen „Walchen” (= Romanen) bzw. Slawen in ihren günstigen, meist sonnseitig gelegenen Siedlungen verblieben, sodass die neu zugezogenen Baiern mit den weniger vorteilhaften Plätzen vorlieb nehmen mussten. Ein klassisches Beispiel dafür sind in Tirol die Dörfer Inzing, Hatting, Flaurling u. a., die an der Schattseite des Inntales der romanischen oder noch älter besiedelten Gegend von Telfs bis Zirl gegenüberliegen.
Für die ganze weitere Besiedlung des Landes wurde auch den Klöstern eine große Aufgabe zugewiesen: sie sollten wohl den christlichen Glauben verbreiten, dazu aber auch das Land kultivieren und dazu wieder deutsche Siedler ins Land holen. Für Salzburg hatten hier das Erzstift St. Peter und Nonnberg die größte Bedeutung, dazu auch das Domkapitel und die Klöster Admont und St. Lambrecht; für Tirol war vor allem das Kloster Innichen ein Vorposten gegen die eindringenden Slawen.
Als das meiste vorerst brauchbare Land besiedelt war und die Bevölkerung weiter zunahm, fand man etwa ab 1.000 n.Chr. eine neue Lösung mit der Anlage von „Schwaighöfen”, für die gesonderte Steuerbestimmungen existierten: Man gab Jungbauern und ihren Familien einen gewissen Viehstand und die Möglichkeit, sich im Waldbereich ihre Höfe zu bauen und Felder anzulegen. Um eine „Rodung” im strengen Sinn des Wortes (Ausgraben der Baumwurzeln) kann es sich dabei kaum gehandelt haben; viel eher arbeitete man lange in Form der so genannten „Brandwirtschaft”: Man fällte die Bäume, verbrannte den Abfall und säte seinen Roggen in die Asche. In einem Umlauf von einigen Jahrzehnten folgten Gerste und Hafer, dann Brache und Weide, schließlich Strauchwuchs und Wald, mit dem wieder von vorne begonnen wurde. Ortsnamen wie Brandberg und Brandenberg oder Hof- und Familiennamen wie Brandner oder Feiersinger und der Kärntner Ausdruck „Brentn” für Waldalmen (bzw. „Brentlerin” für Sennerin; „Brentl” für Milchgefäße) weisen noch auf diese Wirtschaftsform hin, die sich z. B. in der Breitenau, Steiermark, bis über den Ersten Weltkrieg hinaus erhalten hat.
Durch diesen „Ausbau des Landes” nahm aber der Viehbestand und damit der Futterbedarf zu. Beides führte – meist auf Kosten des Waldes – zu einer Vergrößerung der „Schwaigen” und vor allem der Almen, mit deren Bewirtschaftung mindestens ein Drittel des benötigten Futters anderweitig erreicht wurde. Eine wichtige technische Voraussetzung war übrigens die Erfindung der jetzigen Form der Sense.
Der Wald, der für diesen Flächenbedarf herhalten musste, blieb im Besitz der Landesherren und musste vornehmlich Holz für die Berg- und Hüttenwerke und die Salinen liefern. Die gegensätzlichen Interessen der Bauern und der „Herrschaft” führten so zu jahrhundertlangen Reibereien: auf den eingeengten Feldern, Wiesen und Weideflächen gab es Schäden und Verluste durch das Wild, doch die Waldwirtschaft wurde wieder durch die Entnahme von Zaun-, Brenn- und Bauholz und durch das Weidevieh (Verbiss und Vertritt der Jungbäume) beeinträchtigt. Verschiedene Strafen für die Übergriffe der Bauern und das Wildschützenwesen waren die Folge.
Schwere Rückschläge für die Entwicklung der Siedlung gab es ab etwa 1350 durch einige Pestepidemien, später durch die Bauernaufstände und die Ausweisung der Protestanten. Viele Schwaighöfe wurden nun zu Niederalmen, zu „Asten” oder zu Zulehen von Bauernhöfen. Nur wenige konnten sich als eigene Höfe behaupten, meist nur mit Hilfe von entsprechendem Almbesitz. Gerade die Almwirtschaft entwickelte sich aber ständig weiter und erreichte im 17. und 18. Jahrhundert einen Höhepunkt, der bis in die Zeit der „industriellen Revolution” anhalten sollte.
Ein Anstoß dazu kam davon, dass es durch gesteigerte Produktion möglich wurde, die ursprünglichen Bauernhöfe auf mehrere Anwesen zu teilen, daher die vielen Hofnamen mit Ober- und Unter-, Vorder- und Hinter- und vor allem all die Hans-, Hias-, Peter- und Tonibauern usw. Mehr Höfe brauchten aber mehr Vieh und für dieses mehr Futter, das man nach wie vor hauptsächlich auf den Almen fand.
Neben dem Weidegang im Sommer gewann man nunmehr auch Winterfutter durch die Nutzung von „Bergmähdern”, das heißt von Grasflächen, die so steil und schwer zugänglich sind, dass sie nicht beweidet werden können, sondern nur – mit viel Mühe und Gefahr – einen Heuvorrat für die Höfe im Tal liefern. Bergmähder stehen also wohl oft in einem gewissen Zusammenhang mit den Almen, gehören aber mit ihrem Ertrag nicht zur Alm, sondern zum Hof. Nur die „Almanger” (meist bei den Hütten) liefern Notfutter für den Fall von Schneewetter.
Für die Almen selbst ist nun endlich eine gewisse Worterklärung angebracht: Der ursprüngliche Ausdruck lautete bestimmt „alp” oder „alb” und hat sich in den romanischen und allemannischen Gebieten und etwas darüber hinaus bis heute erhalten. Bei den Baiern wurde aber in mittelhochdeutscher Zeit die Endungen angehängt (ähnlich wie in Hütt'n, Brugg'n, Straß'n, Sens'n), und allmählich kam es über „alben”, „albm” zur Aussprache und Schreibung von „Alm”. Dieses Wort setzte sich allgemein mehr durch, aber gerade für Zusammensetzungen wie Alpverbesserung, Alpschutz und dergleichen scheint sich das westliche, ältere Wort besser zu eignen. Eine kleine Trennung der Begriffe und Bedeutungen von „Alp”, „Alb” und „Alm” wird auch durch Gesetze und Lehrbücher kaum jemals zu erreichen sein. Und wir werden wohl nie von einer Ochsenalpe in den Kalkalmen reden und schreiben. Hier ist nun auch eine Definition – eine von Dutzenden – des Begriffes „Alm/Alp” angebracht: es handelt sich um „Bergweiden, die von den Höfen, zu denen sie gehören, so abgelegen sind, dass sie von besonderen Stützpunkten aus (Almhütten) mit eigenem Personal (Almleute) bewirtschaftet werden.” Wenigstens bisher stimmte das.
Für die Bewirtschaftung und die Leistungen der Almen/Alpen sind nun aber viele unterschiedliche Voraussetzungen zu bedenken: Von der Höhenlage ist besonders das Klima abhängig, das seinerseits auf das vorhandene Muttergestein einwirkt und so immer eine bestimmte Bodenbildung mit entsprechendem Pflanzenwuchs hervorbringt. Im Land Salzburg liegen demnach die fruchtbarsten Almen in den Schieferalpen (besonders im Mittelpinzgau) und in den Randzonen und Tallagen der Hohen und Niederen Tauern. Dürftiger sind schon die Kernzone der Tauern und das Lungauer Nockgebiet, während in den Kalkalpen gerade der Wasserhaushalt entscheidend sein kann.
Natürlich bringen die Hochalmen mit ihren extremen Klimabedingungen, kurzer Vegetationszeit und artenarmer Vegetation auch einen viel geringeren Ertrag als die Mittel- und Niederalmen in den Hang- und Tallagen der Waldzone (Waldgrenze durchschnittlich um 1800 Meter). Für Hochalmen ist auch oft ein Schneefluchtrecht verbrieft, das heißt: bei Schneefällen darf das Vieh auf tiefer gelegene Weiden anderer Besitzer (meist im Wald) getrieben werden.
Hochalmen sind meistens ziemlich groß und bilden als Einzelalmen organische Teile bestimmter Bauernhöfe. Wenn auch Nieder- und Mittelalmen innerhalb eines Betriebes zusammengehören, sind sie durchaus nicht immer an die Hochalmen nach unten angeschlossen, sondern können sogar über verschiedene Täler verteilt sein. Zwischen ihnen wird dann je nach Futterwuchs im Abstand mehrerer Wochen gewechselt – bei einer Gesamtalmzeit von durchschnittlich 110 Tagen, also ungefähr 15 Wochen. Zu manchen Höfen gehören auch noch „Asten” (in Vorarlberg „Vorsässe” oder „Maiensässe” genannt), auf denen im Frühjahr zuerst geweidet und dann Heu gemacht wird. Nach einer Nachweide im Herbst bleibt das Jungvieh noch auf der Aste, bis der Futtervorrat aufgebraucht ist. Früher zogen die Familien geschlossen auf die Asten, heute werden diese meist nur mehr vom Hof aus genutzt.
Kleinere Höfe haben meistens auch kleinere Almen, doch dafür in den begünstigten Lagen (besonders Mittelalmen). Oft bewirtschaften aber mehrere Bauern eine größere Almweide gemeinsam und haben dazu nur ihre eigenen getrennten Hütten (Beispiele: Postalm im Tennengau, Lanschfeld und Göriacher Almen im Lungau, Kalbrunn- und Reiteralm im Pinzgau, diese beiden auch gemeinsam mit bayerischen Almbauern). Man spricht hier von Gemeinschaftsalmen – zu unterscheiden von einigen Pferde-, Stier- oder Schafalmen, die von den jeweils zuständigen Genossenschaften betrieben werden (u. a. Grieswiesalm im Rauriser Tal). Einen größeren Anteil haben wieder die Servitutsalmen (bei uns meist im Besitz der Bundesforste), an denen die Bauern kein Eigentum, sondern nur ein Nutzungsrecht haben. Bei allen Besitzformen gibt es aber auch die Möglichkeit, dass die Almbauern so genanntes „Zinsvieh” von nicht almbesitzenden Bauern über den Sommer aufnehmen; der entsprechende Weidezins wird dann sehr oft nur durch Arbeitsleistungen abgegolten.
Von den frühesten Anfängen an bedeutete die Nutzung der Almen einen wesentlichen Beitrag zur Selbstversorgung und Existenzsicherung der Familien, natürlich hauptsächlich zur Ernährung (Milch, Milchprodukte, Fleisch) und zur Kleidung (Häute, Felle, Wolle). Über den Weidebetrieb hinaus werden auch manche Produkte von den Almen direkt gewonnen, etwa Beeren und Heilkräuter, Enzian [Gentiana lutea], Speik [Valeriana celtica], isländisches Moos [Schlüsselflechte, Cetraria islandica]. Im Lauf der Jahrhunderte wurde es dann mehr und mehr möglich, gewisse Almprodukte über den Eigenbedarf hinaus in den Handel zu bringen, soweit sie nicht als Steuern vorgeschrieben waren: besonders Schafe, Ochsen, Pferde und natürlich Käse und Butter.
Von hier nun endlich zum Faktor Mensch, der ja im Mittelpunkt der ganzen Betrachtung stehen muss! Ursprünglich war es vorwiegend Aufgabe der Männer, Tiere zu zähmen und zu lenken. Das Melken und die Butter- und Käsebereitung war anfangs wohl Frauenarbeit und ist es im Großteil Salzburgs und weiter östlich davon auch heute noch. Vom Oberpinzgau und dem Brixen- und Zillertal westwärts ist die ganze Almarbeit aber meist Sache der Männer: Melker, Senner, „Hüater” und Putzer gegenüber den Sennerinnen, „Haltern” und Halterbuben im Osten. Statt „Sennerin” sagt man übrigens in der Steiermark meist „Schwoagerin” und in Teilen Kärntens „Brentlerin” – beides Hinweise auf die mittelalterliche Schwaighof-Siedlung.
Für die Arbeit auf der Alm ist allerdings nicht jeder und jede gleich geeignet und nicht jede oder jeder ist auch bereit, die Einsamkeit und die Härten des Almlebens auf sich zu nehmen. Kraft und Gesundheit sind wichtige Voraussetzungen, sie werden auf der Alm aber zusätzlich gefördert. Denn das Reizklima der Hochregion (Extreme von Strahlung, Temperatur, Wind und Niederschlägen) und der geringe Luftdruck stärken die Gesundheit und vermitteln ein Hochgefühl, das manche Leute geradezu „bergsüchtig” macht. Für die Almarbeit sind dann auch Selbständigkeit, Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein ebenso gefordert wie Können und Sorgfalt bei der Milchverarbeitung und Verständnis für die Tiere und die Weidewirtschaft. Die Liebe zum Tier zeigt sich ja in Kuhnamen wie „Glück”, „Segna”, „Freuda”, „Gamsa”, „Bloama” u. a. Und gerade für den Almbauern ist das Vieh mehr Partner als Produkt.
Früher war es vielfach eine Stufe der bergbäuerlichen Berufsausbildung, dass Burschen und Mädchen für einige Jahre die Almarbeit erlernen und durchmachen mussten. Aber daneben gab und gibt es immer noch Leute, für die das Leben auf der Alm geradezu den Lebensinhalt darstellt. Für den Almbetrieb sind über die Weidemöglichkeiten hinaus gewisse „Almeinrichtungen” notwendig; vor allem Gebäude, Wege, Einfriedungen und nicht zuletzt eine gesicherte Wasserversorgung. Als erstes braucht es hier wohl Wege. Genügten am Anfang einfache Triebwege und Steige, so schuf man später wenigstens Schleifspuren für Sommerschlitten und schließlich Fahrwege, die heute eher ein finanzielles als ein technisches Problem sind.
An Almgebäuden, die nur im Sommer gebraucht wurden, genügten anfangs einfache Hirtenunterstände, je nach Höhenlage ganz aus Stein oder als Rindenhütten, wie sie von Holzknechten noch bis um 1950 aufgestellt wurden. Als bessere Unterkünfte dienten zuerst Einraum-Hütten in Stein oder Holz, doch bald kam es allgemein zu einer Teilung in Küche, Keller und Stube (zugleich Schlafraum). Hauptstück der Küche war der offene Herd, und wo man Käsekessel brauchte, hingen diese an der „Kesselreid”, man könnte sie als einen schwenkbaren einarmigen Galgen beschreiben. Als Bedachung herrschen im Osten steile Bretterdächer vor, im Westen durchwegs flachere Dächer aus beschwerten Legschindeln oder aus Steinplatten.
Das Vieh blieb früher vielfach den ganzen Sommer über im Freien, wo gegendweise auch heute noch die Kühe gemolken werden. Bei den späteren Stallbauten weisen meist noch die Namen darauf hin, dass das Vieh nur um die Hütte herumstand: „Stall” bedeutet eigentlich Standplatz; „Tred” oder „Trempel” (im Tennengau, Pongau und Ennsgebiet) bezieht sich auf das Herumtreten der Tiere bei der Hütte. „Hag”, das Wort für die Almställe im Tiroler Unterland, weist ebenso wie „Pferch” auf Einfriedungen hin (Steinwälle oder Zäune). „Scherm” (besonders im Pinzgau) gilt schließlich für ein beschirmendes Dach. Heute werden meist noch die hochgelegenen Galtviehställe, in denen das Vieh Schutz vor Hitze oder Unwetter findet, aber nicht gefüttert wird, als „Scherm” bezeichnet.
Je nach Bedarf und Gegend sind die Almgebäude als Ein-, Paar- oder Gruppenhöfe angelegt, und diese Hofformen gelten auch für die Höfe im Tal, ebenso wie die einzelnen Bauten, für die die Almgebäude die Urformen und Vorbilder darstellen. Das nächste Erfordernis sind geeignete Einfriedungen und Abgrenzungen, um die Tiere von Gefahrenstellen abzuhalten und innerhalb der Besitzgrenzen zu bewahren. Auch hiefür verwendete man auf Hochalmen zunächst Steine, die zu niederen Trockenmauern (meist „Hag” genannt) aufgeschlichtet werden, wobei man gleichzeitig die benachbarten Weideflächen säubert. Tiefer im Wald ist wieder Holz das gegebene Baumaterial, entweder aus Stangen und Stecken oder aus gespaltenen Stecken und „Girschtn” (gespaltene Latten) in verschiedener Bauweise zu Zäunen aufgestellt. Wegen des winterlichen Schneedrucks werden im Herbst von den Almleuten die Zäune „abgelegt” und im Frühling vor dem Almauftrieb von den Männern des Hofes in tagelanger Arbeit wieder errichtet.
Zäune erlauben es auch, eine Alm zu unterteilen, etwa in „Halten” für Kälber, Jungstiere, Ochsen oder in eine Kuh- und Galtviehalm; ganz abgesehen von den Elektrozäunen, mit denen man heute jeweils für die Weide einiger Tage kleine Flächen vorgibt. Pferde, Schafe und Ziegen würden im Weidebetrieb die beste Ergänzung zu den Rindern bilden, aber für große Schafherden gibt es ohnehin dort und da die hochgelegenen Schafalmen. Schweine nimmt man auf milchverarbeitende Almen mit zur Verwertung der Abfälle und besonders der Molke („Juttn”, im Lungau „Kaawåssa” genannt – von daher der Name eines Sees im obersten Murtal).
Wasser ist für Mensch und Tier und für viele Arbeiten in den Hütten (lebens-)notwendig, oft wird es auch für Bewässerungen oder zum Antrieb der „Rührkübel” (Butterfass) eingesetzt. Meist ist es reichlich vorhanden, und Almhütten stehen oft in der Nähe von Quellen oder Bächen. Manchmal muss es aber zugeleitet werden, und in trockenen Gebieten der Kalkalpen behilft man sich sogar, indem man Schmelz- oder Niederschlagswasser in Zisternen sammelt. Man sieht: Unsere Vorfahren wussten sich zu helfen und haben in den letzten Jahrhunderten die Alpwirtschaft auf einen wirklich hohen Entwicklungsstand gebracht. Seit etwa 150 Jahren steht aber die ganze Gesellschaft und mit ihr der Bauernstand in einem Umschwung, der eine neue Lebensweise erzwingt, dazu aber auch nie da gewesene Möglichkeiten bietet. Wir sprechen von der „industriellen Revolution”, die nicht etwa an einem bestimmten 1. Mai stattfand, sondern nur allmählich, aber immer stärker unser Leben erfasst.
Für die Bauern und ihre Alpwirtschaft bedeutete sie den Umstieg von der Selbstversorgung auf die Marktwirtschaft, in der immer weniger Leute immer mehr andere versorgen sollen. Viele Arbeitskräfte wanderten vom Land ab, und viele Bauern wurden durch die vielgepriesene Bauernbefreiung so hoffnungslos verschuldet, dass ganze Täler (besonders in der Steiermark) entsiedelt und von Großgrundbesitzern und Unternehmern für Forst- und Jagdzwecke aufgekauft wurden.
Auf den Almen vollzog sich die Umstellung etwas langsamer: Man ging auf Ochsen-„produktion” über, baute die Wege aus, arbeitete mit neuen Geräten (z. B. „Milchmaschinen”) und erzeugte anspruchsvollere Käsesorten („Pinzgerkas”, Bergkäse) statt der alten Zinskäslein. Noch gab es Personal aus der eigenen Familie oder Hofgemeinschaft, immer öfter aber auch Fachkräfte (Senner, Melker, Sennerinnen), die sich nur über den Sommer verdingten, oft freilich für viele Jahre.
Sie alle wussten das Almleben zu schätzen und nahmen daher auch alle Mühen auf sich: Vor allem gibt es in der Almarbeit keine Freizeit; es ist immer etwas zu tun, auch wenn man sich einmal „a bissl doniloahnt”, um ein wenig zu rasten. Man ist vom Wetter abhängig, aber es geht dabei nur darum, was man bei Schönwetter tun kann oder darf und was man auch bei „Sauwetter” noch tun muss. Man muss z. B. die Tiere suchen und von Gefahrenstellen ablenken; man muss ihnen, besonders den Schafen, Salz geben (womöglich mit Kleie vermischt) – und wenn sie sich auf bestimmte Lockrufe hin herandrängen, kann auch das für den Menschen gefährlich werden. „Man muss” noch dieses und jenes, aber in einem Bericht über das Almleben (aus Wagrain, 1950) heißt es: „... es gibt keinen Parteihader, keine Machtgier und Streitsucht, ... alles ist Friede und heilige Ruhe ... und ... Wer einmal Sennerin und Hirte war, kennt dieses Gefühl und es begleitet ihn sein Leben lang”.
Im geregelten Tagesablauf gibt es doch noch viel Freiheit auf der Alm. Es kann aber recht einsam sein, besonders auf den Hochalmen, deren Hütten oft eine halbe Gehstunde oder noch weiter voneinander entfernt stehen, während es auf den Gemeinschaftsalmen meistens recht gesellig hergeht. Es bedeutet viel, wenn die Almleute untereinander und mit den Leuten im Dorf bekannt sind. Und früher kamen an schönen Sonntagen oder auch sonst die „Jåggaser” (Besucher um den Jakobstag, 25. Juli, oder besondere Verehrer) und die „Hoaminga” aus den Dörfern auf Besuch zu den Sennerinnen und „Almingern”. Sie unterhielten sich mit Gesang und Tanz und wurden mit einer „Moasn” (verzierte Butter), Rahmkoch oder anderen Köstlichkeiten bewirtet.
In den Städten besannen sich nun die neu Zugezogenen auf die Schönheiten der vorher verlassenen Heimat, sammelten sich in Geselligkeits-, Wander- und Gebirgstrachtenerhaltungsvereinen und veranstalteten ihre „Almpartien”. Denn längst hatten auch Dichter und Maler die Großartigkeit und Romantik der vorher „schröcklichen Gepürge” verkündet, und die ersten Bergsteiger suchten auf den Almhütten Unterkunft und Labung. So zog auf den Almen ein neues Leben ein. Früher hatte man auf den Almen noch selbstironisch gesungen:
„Auf der Alm is's koa(n) Bleibm
tuats bald regna bald schneibm;
a' da Hüttn is's koa(n) Sein,
geht der Wind aus und ein.”
Oder es hieß in einer Halterbuben-Klage:
”... d' Senndinna sand rechte Trümmer,
wer's nit saach, der glabat's nimmer”.
Aber nun fand das neue Lebensgefühl einen anderen Ausdruck, etwa:
„Es gibt koa(n) schöner's Lebm nit
als droben im Gebirg;
i tausch mit koaner Gräfin nit
mit aller Pracht geziert ...”
Oder noch besser und bekannter:
„Von der Alpe ragt ein Haus
lieblich über's Tal hinaus;
drinnen wohnt mit frohem Sinn
eine schöne Sennerin.
Senn'rin singt bei Sturm und Wind:
auf der Alm, da gibt's koa(n) Sünd'”.
Mit derlei Sprüchen bestickten nun auch die Sennerinnen ihr vorgedruckten „Wandschoner”, (Baumwolltücher, in Stilstich rot oder blau bestickt, zwischen 1900 und 1940) z. B.:
„An diesem Hüttlein in stiller Ruh
bring ich mein Alpenleben zu”.
(Nichts vom „Küahsuachn” bei Hagel oder Nebel und Schneetreiben!)
Entgegen aller Schwärmerei und der gelobten Freiheit des Almlebens ging (und geht) aber doch die Zahl der Almleute zurück, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. Und abhängig von den örtlichen und betrieblichen Verhältnissen vollzieht sich die Umwandlung in der Almwirtschaft verschiedenartig und nicht überall gleichzeitig, doch sind gewisse allgemeine Entwicklungslinien schon deutlich zu erkennen.
Der Personalmangel ist jedenfalls ein auslösendes Moment; ohne Sennerin oder Melker kann man keine Melkkühe mehr auf die Alm geben. In manchen Fällen springen noch die alten Bauersleute ein, aber die können eine größere Herde nicht mehr betreuen und behelfen sich höchstens mit einer oder zwei Kühen für den Eigenbedarf. Der Bergbauer erarbeitet aber den Großteil seines Einkommens mit Milch und Zuchtvieh, daher werden die Kühe beim Hof behalten, wo sie mit bester Fütterung und geringerer Anstrengung die größte Milchleistung erbringen (was allerdings in höherem Maße auch in Holland und Norddeutschland zutrifft!).
Auf die Almen kommt nun hauptsächlich Galtvieh (Jungvieh); da der Viehbestand im Ganzen aber eher ab- als zunimmt, wird die Weide nur noch zur Hälfte genutzt. Das Vieh holt sich die besten Kräuter und Gräser und ruht auf den angenehmsten Plätzen. Diese Stellen werden dabei vom Vieh überdüngt und es bildet sich die so genannte „Lägerflora”: meist von Brennnesseln und Alpenampfer (im Pinzgau „Foissn”, im Lungau „Plotschn” – früher zum Einwickeln von Butter verwendet) oder auf Schafweiden besonders von Eisenhut. Bei zu geringer Beweidung breitet sich überall, vor allem aber auf trockenen, sauren und nährstoffarmen Böden, der „Bürstling” (Borstgras) aus, der nur im jungen Zustand und eher von Pferden und Schafen angenommen wird – und auch das nur, wenn in der Nähe keine bessere Weide vorhanden ist.
Ein anderes Ergebnis extensiver Wirtschaft ist es, dass Almen überhaupt nach und nach „zuwachsen”. Auf den Nieder- und Mittelalmen kommt wieder der Wald als die naturgegebene Vegetation (daher werden sie auch oft aufgeforstet). Höher oben siedeln sich Latschen (auf Kalk und trockenen Böden) oder Grünerlen an (auf Urgestein und in schneereichen Lagen) und weitum nehmen Alpenrosen überhand: „Ålmarausch, bist a schön's Bleamal”, heißt es im Lied – für den Almbauern sind sie jedoch ein böses Unkraut.
Aber wenn auch nur Jungvieh auf den Almen ist, muss doch immer wieder nachgeschaut werden. Und wurden früher Käse und Butter auf Schlitten oder Kraxen zu Tal befördert, so ist heute eine Alm kaum noch zu halten, wenn sie nicht mit einem Motorfahrzeug erreicht werden kann. Vergangenheit sind heute schon wieder zwei Transportmittel der 30er bis 70er Jahre: Seilbahnen (eigentlich Seilaufzüge) und Schlauchleitungen, mit denen man von den Hochalmen die Milch ins Tal lieferte.
Und wenn man über „das ganze moderne Zeug da” klagt -, ist es nicht angenehm, dass man schon auf vielen Almen mit Elektrizität (besonders zum Melken) und praktisch überall mit dem „Handy” arbeiten kann, z. B. beim Schafsuchen, für den Ruf nach dem Tierarzt oder zum Hof oder zu sonst wem? Bei den neuen Möglichkeiten der Erdbewegung und Felssprengung können Almwege praktisch überall hin gebaut werden. Man befördert daher beliebige Baustoffe, Lebens- und Futtermittel und auch Tiere leicht auf die Almen und Milch oder alle anderen Almprodukte ebenso leicht zum Hof bzw. zur Molkerei.
Auf dem Almweg sind jetzt der Bauer mit dem Güllefass und der „Hüater” mit seiner „Maschin” nicht mehr allein. Denn die Nachkommen der Städter, die im 19. Jahrhundert die Berge entdeckt haben – und heute leben ja viele Leute auf dem Land ebenso städtisch -, ziehen so wie die Gäste aus aller Welt in Scharen auf die Almen. Und wenn es heißt, eine Alm sei „bewirtschaftet”, dann gibt es dort vielleicht keine Kuh mehr, wohl aber einen „Klaren”, ein Bier oder Cola und dazu ein Schnitzel mit Pommes und Ketchup. Der Bauer oder der Lieferwagen vom Großmarkt hat ja alles heraufgebracht. Doch soweit es eigene Produkte von der Alm und vom Hof gibt, werden diese in erster Linie angeboten.
So manche Leute kommen mit ihren Familien oder Freunden immer wieder gern auf die Almen und sind glücklich, wenn sie eine von den Hütten, die die Bauern nicht mehr benützen, mieten können. Beiden Seiten ist geholfen: für den Bauern bedeutet es doch eine gewisse Einnahme und seine Hütte wird – wenn auch nicht immer nach seinem Geschmack – instand gehalten, und der Pächter hat einen sicheren Zutritt zu einem günstigen Stützpunkt, auf dem er Höhenluft genießen kann. Für ihn ist es „seine” Alm, und er grenzt sie noch gerne ein mit einem „echten Pinzger” oder Jägerzaun.3
Allerdings erwarten sich alle Wanderer und Almhütten-Pächter eine „Kulturlandschaft”, wobei Kultur im vollen Sinn nicht nur als hochgeistige, sondern auch als mitmenschliche und materielle Leistung und Lebensform gelten sollte. Anders und kurz gesagt: es soll ein gepflegter Zustand vorhanden sein. Pflege auf der Alm war früher die Arbeit der „Putzer”: Steine räumen, Unkraut bekämpfen, Gräben und Bäche sichern, für Be- und Entwässerung und für Düngung sorgen und Wege instand halten. Aber Putzer gibt es kaum noch, und die eigentlichen Almpfleger, die weidenden Tiere, gibt es auch nicht immer. Hier trifft nun ein Spruch aus bairischer Erfahrung zu: „Wo koa(n) Kuah mehr geht, geht ah koa(n) Preuß nimma hin”. Die Öffentlichkeit verlangt eben, dass die Almen weiterhin bewirtschaftet (oder wenigstens gepflegt) werden sollen, aber das bedeuten (in Prozenten): 5 Bauern sollen für 95 Personen hochwertige, billige Lebensmittel und Tausende Hektar Kulturlandschaft erzeugen. Wie soll das nun gehen?
Nicht ganz befriedigend ist hier ein Bericht vom Josefitag (Josephitag: 19. März; als Patron der ledigen Männer, später der Arbeiter) 2002 in den Salzburger Nachrichten. Zwei Überschriften verkünden: „Bauern lassen viele Almen verwildern” und „Die Alm hat wenig Zukunft”. (Die Nummer, einschließlich der Karikatur von Wizany und der Glosse „Leo”, ist überdenkenswert!). Aber nun wäre zu fragen: „Welche Bauern und welche Alm?” Wird nicht ohnehin immer und überall allzu viel verwildern gelassen?! Was soll ein Bauer mit seiner Alm tun, wenn er die letzte Kuh verkauft, vielleicht überhaupt seinen Betrieb aufgelassen hat? Es gibt jedoch Wege – und Beispiele, dass diese Wege begehbar sind! Aber neben den natürlichen und betrieblichen Voraussetzungen werden es hauptsächlich persönliche Bedingungen sein, unter denen es auf dem „Almweg” weitergeht. In den höheren landwirtschaftlichen Schulen wird neuerdings „Management und Marketing” unterrichtet. Wird man da aber berücksichtigen, dass über 45 % unseres Landes aus Wald bestehen, 35 % aus Almen und Ödland und 10 % aus Verkehrs- und Gewerbeflächen?
Doch wie sieht es in der Praxis aus? Verkaufen – allzu oft als Baugründe – oder verpachten wären die billigsten Lösungen. Fremdes Vieh gegen einen angemessenen Weidezins aufzunehmen hat schon mehr Sinn, denn die Milchbauern im Flachgau und Innviertel wissen längst, wie sehr ihrem Jungvieh ein paar Sommer auf der Alm gut tun. 100 Kilometer Antransport im Lastwagen ist da kein Problem mehr. Doch ob dabei das Vieh bei der Verladung gesegnet wird, wie früher vor dem Almauftrieb, ist eine andere Frage. Sollte nun doch wieder Personal notwendig sein – auch dieses gibt es, wenn auch nie zur Genüge. Seit Jahren bieten sich Leute an, die auf Almen arbeiten wollen. Anfangs gab es Schwierigkeiten mit solchen, die sich nur einen billigen, lustigen und gesunden Urlaub erwarteten. Aber es kommen auch andere, die wirklich die Almarbeit suchen und verstehen, und StudentInnen aus den Berggebieten, die mit dem Vieh und der Almwirtschaft vertraut sind und auch anpacken, wo es Not tut – und sei es nur als Helfer für die Altbäuerin, die noch oder wieder als Sennerin auf die Alm geht. Es geht auch umgekehrt: Altbauern betreuen über den Sommer den leerstehenden Hof, während die ganze Familie mit dem ganzen Viehstand und der nötigen „Maschinerie” auf der Alm lebt. So nebenbei wird von der Alm aus die Heuarbeit beim Hof besorgt, aber oben wird je nach Möglichkeit intensiv gewirtschaftet – oft einschließlich Gastbetrieb.
Nur – für viele Bräuche, die früher im Almleben wirklich gebraucht wurden, fehlen jetzt die Grundlagen – und vor allem die Leute und die Zeit. Vieles war auf gute Nachbarschaft aufgebaut (war), hat für eine anonyme Zuschauerschaft keinen Sinn – und kann man Almleben auf der Bühne aufführen? Welcher aufgeklärte Zeitgenosse (auch Bauer und „Alminger”) glaubt noch an Glück und Gesundheit, wenn die Tiere vor dem Almauftrieb über Zweige vom Palmbuschen steigen müssen und mit Weihwasser besprengt werden. (Freilich, ein stilles Gebet wird ihnen bestimmt noch folgen.) Schutzzeichen und geweihte Dinge werden als Aberglauben aufgefasst und abgetan.
Welcher Bauer lässt seine Alm noch vom Priester segnen? Wenigstens Alm- und Bergmessen werden von Einheimischen und Gästen besucht und mitgefeiert. Für die alten Spiele und Wettkämpfe der „Halter” fehlen diese Halter selbst. Und nur selten wagt jemand einen Juchizer oder Jodler, und für die Almtänze in den Hütten fehlen die Tänzer. Aber wer will, der kann ja in eine Alm-Disco gehen, nur bitte stilecht in schulterfreier, „trachtiger” Landhausmode!
Aber es gibt auch die Alm-Familien, die dem Besucher Zeit schenken und die in Vertrauen und Dankbarkeit ihr Tischgebet und Stallgebet halten. Und bei denen beim Almabtrieb – mit Segen für das Vieh – noch „aufkranzt” wird. Zwar ist ein Almabtrieb der „alten Art” kaum noch denkbar, weil die meisten Tiere mit Lastwagen abgeführt und womöglich auf fünf Gemeinden verteilt werden. Wo es geht, gibt es wenigstens auf den letzten Kilometern diesen „Triumphzug” aus Dankbarkeit und Stolz. Reich geschmückt, meist mit einem Spiegel auf der Stirn und mit der schwersten Glocke behangen, geht die Leitkuh dem Zug voran, begleitet vom obersten Hirten und gefolgt vom Stier, der mit einem „Poschen” (Fichten- oder Zirbenwipfel) auf dem Haupt geziert ist. Je nach Rang tragen auch die übrigen Tiere einen Schmuck aus Zweigen, Blumen und Flitter. Dahinter fährt der Bauer mit der Sennerin und den Almerträgnissen auf einem Wagen, aber die Sennerin steigt immer wieder ab und reicht aus einem Korb den Zuschauern „Schnuraus” (schon vorher im Haus gebackene, gut nussgroße Stücke aus einem krapfenähnlichen Buttermürb-Teig) oder anderes ähnliches Backwerk. Beim Hof erwartet die Bäuerin den ganzen Zug und segnet, wie vor der Auffahrt, die Tiere mit Weihwasser.
Solche Albfahrten haben heute freilich Seltenheitswert, aber dafür werden mancherorts ganz großartige „Almabtriebe” praktiziert und veranstaltet, wie auch andere Bräuche nur mehr aufgeführt und zu Volksfesten umgestaltet werden. Denn der Tourist braucht „Events” und Feste (und Fotomotive) – und der Tourismusverband langt nach dem Euro. Bergbauern – soweit sie nicht nur mehr Nebenerwerbsbauern sind – sind immer noch hauptsächlich auf den Ertrag von Vieh und Milch angewiesen und konzentrieren sich daher ganz auf den Hof, wo sie ihre Milch leichter und billiger produzieren können als auf der Alm. Manche aber bauen auf den Almen modern eingerichtete Ställe, betreiben Güllerei mit Koppelweide (mit Elektrozäunen als große Hilfe) und sichern so Fleischzuwachs und Milchleistung.
Am ehesten hätte es Sinn, die Milch selbst zu verarbeiten (wieder die Frage: wer tut's?) und Käse und Butter direkt auf der Alm, sonst „ab Hof” oder auf Bauernmärkten günstig zu verkaufen, doch darin steckt so viel Risiko, wie wenn in einer ganzen verregneten Woche kein Gast auf die „bewirtschaftete” Alm kommt. Zwei Gegenden wären hier als vorbildlich für die ganze Alpwirtschaft zu nennen: der Bregenzer Wald und das Allgäu. Zu erwähnen ist sicher auch die gute Almwerbung durch die Nationalparkverwaltung, und ebenso ist der ORF-Sender Salzburg für seine Almsendungen und Wandervorschläge zu loben.
Immer mehr Almgeschäft „geht” heute allerdings im Winter, denn die meisten Almen bieten von Natur aus ein ideales Gelände für den Wintersport. Und praktisch wie Bauern – auch von Natur aus – meistens sind, machen sie aus ihren Hütten Verpflegungs- und Beherbergungsbetriebe (mit modernen „Häusln”/WCs – nicht zu vergessen!). Für die notwendigen Aus- und Umbauten gibt es genug Vorbilder und Beispiele zwischen Stahl- und Glas- oder Lederhosenstil, und die Bewirtschaftung wird meistens von Fachleuten aus der Gegend übernommen. Aber der „Rubel rollt” auch hier, freilich auch wieder mit allerhand Risiko. Wie sich allerdings die Anlage der Pisten für den Sommerbetrieb auswirkt, muss sich erst erweisen; hier haben die Liftgesellschaften und Tourismusverbände eine gewisse Aufgabe. Aber wäre es nicht auch denkbar, dass Trupps von Zivildienern für die Pflege der Almen und Schutzwälder eingesetzt würden? Nur müsste dazu vielleicht das Buch „Alpverbesserungen” von Rudolf Kober (Wien 1937, 650 Seiten!) neu geschrieben werden.
Man sieht, es gäbe gewisse Möglichkeiten, dass die Berg- und Almbauern das erfüllen, was die „Öffentlichkeit” von ihnen erwartet, doch jeder wird seinen eigenen Weg finden und gehen müssen. Zwar gelten hier die Naturgesetze: „Ohne Geld koa Musi” und „Wer zahlt, der schafft an”. Diesen Satz müsste man jedoch umkehren: „Wer anschafft, der soll auch zahlen!” Immerhin gibt es die „Alpungsprämien” (nach Zahl und Art der Tiere und nach der Futterfläche) und kurzfristige Förderungen für Investitionen auf den Almen; doch diese „Hilfe von oben” genügt noch nicht, um die Almen auch wirklich zu erhalten.
Aber die Bergbauern, die seit dem Mittelalter ihren Grundherren gedient haben und die immer noch eher als ihre Kollegen im Flachland auf ihren Höfen bleiben, werden sich auch weiterhin, vielleicht zähneknirschend, für die „neue Herrschaft”, die Allgemeinheit, abmühen, wenn ihnen nur das Verständnis und Wohlwollen entgegengebracht wird, für welches auch dieser Bericht werben sollte. Der materielle Gewinn allein wird nicht ausreichen; darum ist es nur von der Liebe zu den Almen zu erhoffen, dass das Almleben am Leben bleibt. An diese Auffassung erinnert auch der Buchtitel „Heimat als Erbe und Auftrag” (Festschrift für Hofrat Dr. Kurt Conrad, den Begründer des Salzburger Freilichtmuseums). Und ist nicht dieses Almleben auch Gottesdienst – nahe dem Himmel, mit großer Dankbarkeit, aber mit viel Verantwortung? Denn nicht nur wir brauchen die Almen und einen gewissen Almbrauch, auch die Almen brauchen uns!
Verwendete Literatur:
[Acker-Sutter 1984] Acker-Sutter, Rotraut (Hg.): Heimat als Erbe und Auftrag. Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte. Festschrift für Kurt Conrad, Direktor des Salzburger Freilichtmuseums, zum 65. Geburtstag. Salzburg 1984.
[Adrian 1924] Adrian, Karl: Von Salzburger Sitt' und Brauch. Wien 1924 (Deutsche Hausbücherei 135/138).
[Der Alm- und Bergbauer] Almwirtschaft Österreich (Hg.): Der Alm- und Bergbauer: die Fachzeitschrift für den bergbäuerlichen Raum. Innsbruck (unter diesem Titel ab Jg. 23.1973).
[Conrad 1990] Die Landschaft als Spiegelbild der Volkskultur. Salzburg 1990 (13. Ergänzungsband zu Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde).
[HaidH 1996] Haid, Hans: Vom alten Leben. Vergehende Existenz- und Arbeitsformen im Alpenbereich. Wien [u. a.] 1996.
[Hänsel 1988] Hänsel, Volker (Hg.): Vom Leben auf der Alm. Ausstellungskatalog. Trautenfels 1988.
[Hubatschek 1950] Hubatschek, Erika: Almen und Bergmähder im oberen Lungau. Salzburg 1950.
[Hubatschek 1961] Hubatschek, Erika: Bauernwerk in den Bergen. Innsbruck 1961.
[Keidel 1936] Keidel, Franz: Die Almen und die Almwirtschaft im Pinzgau. Zell am See 1936.
[Kober 1937] Kober, Rudolf: Alpverbesserungen. Wien 1937.
[ÖVA 1959] Kommission für den Volkskundeatlas in Österreich (Hg.): Österreichischer Volkskundeatlas. 8 Kommentarbde. Wien [u. a.] 1959–1981.
[PeterI 1976] Peter, Ilka: Tanz der Pinzgauer Almleute zu brauchtümlich gebundenen Anlässen. In: Jahrbuch ÖVLW 25 (1976), S. 8–27.
[PietschM 1961] Pietsch, Max: Die industrielle Revolution. Von Watts Dampfmaschine zu Automation und Atomkernspaltung. Freiburg im Breisgau [u. a.] 1961 (Herder-Bücherei 93).
[Schneiter 1948] Schneiter, Fritz: Alpwirtschaft. Graz 1948.
[WeberAlf 1960] Weber, Alfred: Kulturgeschichte als Kultursoziologie. Ungekürzte Neuausg. München 1960.
[WeissR 1941] Weiß, Richard: Das Alpwesen Graubündens. Wirtschaft, Sachkultur, Recht, Älplerarbeit und Älplerleben. Zürich 1941.
[WernerP 1981] Werner, Paul: Almen. Bäuerliches Wirtschaftsleben in den Alpen. München 1981.
[Wolfram 1979] Wolfram, Richard: Almbrauchtum. In: ÖVA. Kommentar VIII, 2. Teil, Bl. 79–82.
[Zinnburg 1977a] Zinnburg, Karl: Salzburger Volksbräuche. 2. Aufl. Salzburg 1977.
[Zwittkovits 1974a] Zwittkovits, Franz: Almen und Almwirtschaft in Österreich. In: ÖVK, Lfg. 5. (1974).
[Zwittkovits 1974b] Zwittkovits, Franz: Die Almen Österreichs. Willingdorf 1974.