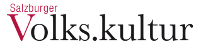

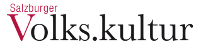

In den letzten 20 Jahren sind das Bemühen und das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Kulturvermittlung kontinuierlich gestiegen. Gerade wegen unserer globalisierten Welt suchen die Menschen erst recht wieder das Individuelle, das Eigenständige, das Unverwechselbare, das Besondere, das Unterscheidbare, das Regionale, die Vielfalt. Die Museen als nicht unwesentliche Kulturträger beziehungsweise Tradierer von regionaler Kultur und Geschichte haben dabei einen wichtigen Auftrag zu erfüllen.
Neben Sammeln/Erwerben, Bewahren, Erforschen/Dokumentieren und Ausstellen – den nach ICOM-Definition[2996] wesentlichen Säulen – gehört die Vermittlung, also die Arbeit für das und mit dem Publikum, mit zu den wesentlichen Aufgaben heutiger Museumsarbeit. Je mehr die Museen in die breite Öffentlichkeit rücken und auch Förderungen der öffentlichen Hand erhalten, umso stärker haben sie auch bestimmte Aufgaben zu erfüllen, zu denen – mehr denn je – die Vermittlung der musealen Bestände an unterschiedliche Zielgruppen gehört. Es geht also um Information und Kommunikation im Museum zwischen Besucher und Exponat beziehungsweise Besucher und Museumsinhalten, das heißt es ist für jeden Museumsverantwortlichen zu überlegen: was will ich mit meiner Ausstellung, mit meinen gesammelten und zur Schau gestellten Objekten wie und mit welchen Mitteln und Methoden welchen Besuchern mitteilen beziehungsweise verständlich machen – und warum?
Bildung/Pädagogik kann sich nicht leisten, Museen zu ignorieren[2998] – ein Plädoyer für die Wichtigkeit des Einsatzes von Museumspädagogik, das Molly Harrison bereits 1960 bei einer UNESCO-Tagung weiter ausführte: Wenn Museen weiterhin eine echte Funktion haben wollen, dann kommen sie an Museumspädagogik nicht vorbei.
Frühe Sammlungen lassen sich aus ganz bestimmten Sammlerinteressen heraus verstehen. Die Schatzhorte und Schatzkammern dienten zunächst der materiellen Existenzsicherung, ihre etwaige Präsentation diente allenfalls der Dokumentation materiellen Vermögens. Der enge Bezug zwischen der Entstehung einer Sammlung und ihrer Nutzung, ihr Eingebundensein in konkrete und vitale Verwertungsinteressen charakterisierte das frühe Sammlungswesen.[2999]
Es war ursprünglich kaum Absicht der Museen, museumspädagogisch zu wirken, eher im Gegenteil. Von den Gründungsintentionen her war es nicht notwendig. Die meisten Museen sind aus Privatsammlungen hervorgegangen, deren Bestände der Objekte wegen und zum eigenen Vergnügen von privaten Einzelpersonen zusammengetragen und gesammelt wurden.[3000] Der Sammler wusste, was und warum er sammelte, kannte Umfeld, Entstehungsdatum, vielleicht auch den Hersteller der Objekte etc. Er sah seine Objekte immer nur in einem für seine Zwecke relevanten Bedeutungszusammenhang. Er brauchte bloß genug Platz, um sie unterzubringen. Die Sammlungen waren in erster Linie für den Sammler selbst bestimmt, der sie gegebenenfalls persönlichen Bekannten zeigte.[3001]
Bildungs- beziehungsweise Erziehungsfunktion oder pädagogische Absicht war dabei keine dahinter. Genauso wenig haben Studiensammlungen, die von einem Fachmann geleitet und auch nur von „Leuten vom Fach” angeschaut beziehungsweise meist auch nur Fachkollegen gezeigt werden, irgendeine museumspädagogische Absicht. Es sollen hier beim Betrachter keine weiterreichenden Assoziationen hervorgerufen werden (für die Experten genügt der Seltenheitscharakter eines Exponats oder das zahlreiche Vorhandensein eines bestimmten Objektes).
Eigentlich hat alles, was ein Museum tut, pädagogischen Charakter, selbst wenn keine Absicht dahinter steckt. Das Niveau und das Design einer Schausammlung, die Art des Arrangements der Exponate, das Verhalten des Museumspersonals, das Layout der Publikationen, die Inhalte der publizierten Werke haben ebenso (didaktisch-)pädagogischen Charakter, das heißt dienen der Vermittlung von Inhalten wie die direkten Vermittlungsangebote.[3002]
Neue oder neu zu gründende Museen sollten daher schon bei der Konzeption besonderen Wert auf diese Bereiche legen und berücksichtigen, für wen sie Schausammlungen aufbereiten. Sobald nämlich Sammlungen einer Öffentlichkeit als Ausstellungen zugänglich gemacht werden, erscheinen die Objekte in neuem Licht und übernehmen eine ganz andere Rolle. Sie sind Teil eines nicht personalen Vermittlungsprozesses, durch den der Laie in eine Sache eingeführt, aufgeklärt werden soll – und zwar über den Hintergrund der Exponate, deren historische Zusammenhänge und Beziehung zu anderen Objekten usw. Viele Museumsobjekte haben selbst keinen oder nur geringen eigentlichen Wert. Sie werden in erster Linie deshalb aufgehoben, bewahrt, weil sie etwas über die ursprünglichen Verhältnisse aussagen können, und nicht, weil es sie gibt. Das bloße Betrachten eines solchen Objektes bringt dem Besucher gar nichts, wenn er den weiteren Kontext, die Zusammenhänge rund um das Exponat, nicht kennt und daher auch nicht begreift.[3003]
Museumspädagogen haben daher die Aufgabe übernommen, objektbezogene Präsentationen den Besuchern verständlicher zu machen. Gerade in etablierten, „alteingesessenen”, Museen ist die Trennlinie zwischen Studiensammlung und Schausammlung oft sehr verschwommen. Es wurden kaum Konzessionen zugunsten derer eingegangen, die leider nicht mit dem jeweils nötigen Hintergrundwissen für ein ausgestelltes Sachgebiet aufwarten können.[3004]
Weschenfelder/Zacharias vermuten, dass solche strukturellen Beziehungen zwischen Museum und Benutzer, wie sie bei den frühen Sammlungen geherrscht haben, nur noch teilweise existieren und glauben, dass lediglich Museumsangestellte und Fachwissenschafter, für die die Museumsgegenstände keine Kunst- und Kulturobjekte „an sich”, sondern Arbeitsmaterial sind, daran teilhaben.[3005] Sie verweisen auf Heiner Treinen, der dieses Strukturverhältnis 1975 so formulierte: „Zusammengefaßt läßt sich das Verhältnis gesammelter Objekte in Museen zum Publikum folgendermaßen umschreiben: Objektsammlungen in Museen gehören nicht unmittelbar zur Alltagserfahrung. Das heißt, im Gegensatz zu vorindustriellen Zeitläufen werden in Museen auch solche Objekte erhalten, die für Privatpersonen völlig bedeutungslos sind. Die Objekte besitzen keine instrumentale Bedeutung für die Besucher. Sie sind weder magisch besetzt noch besitzen sie einen wie auch immer gearteten Aufforderungscharakter zum Handeln noch dienen sie der Selbstdarstellung eines Kollektivs von Menschen. Wohl aber besitzen eben dieselben Objekte Symbolcharakter für die Angehörigen eines bestimmten Wissensbereiches, dem die Objekte zugeordnet werden können.”[3006]
Museen müssen selbstverständlich sammeln und bewahren, jedoch mit einer bestimmten Absicht, einem vorgegebenen Ziel. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Es ist auch jedem Museumsdirektor, jedem Museumsleiter oder Vereinsvorstand – je nach dem, wer darüber entscheidet; am besten wäre ein gemeinsam mit allen MuseumsmitarbeiterInnen erarbeitetes Leitbild – überlassen, ob er sich für eine ausführliche Präsentation weniger Sachgebiete entscheidet oder ob er einen Überblick über viele Sachgebiete vorzieht.[3007] Die Absicht des Museums sollte jedoch in der Präsentation deutlich werden, denn Einstellungen und Meinungen, die nicht kundgetan werden, könnten einen unbeabsichtigten pädagogischen Effekt haben.[3008] Die Museen sollten es als ihre Pflicht ansehen, der Öffentlichkeit die Gründe für das Sammeln und Bewahren zu erklären, jedem einzelnen Mitglied der Gesellschaft die Bedeutung des Konservierens begreiflich zu machen und von ihnen dafür Unterstützung zu fordern. Wenn Museen beziehungsweise deren Verantwortliche dies schaffen, gewinnen sie möglicherweise leichter Förderer, Mäzene, Sponsoren.
Das Argument gegen Museen im herkömmlichen Stil, in denen die Objektdichte sehr groß und der Anteil an Erklärungen und Informationsmaterial eher gering sind, ist nicht, dass solche Sammlungen oftmals keine Freude zum Verweilen ausstrahlen und den Informationsanspruch des Besuchers nicht erfüllen. Es ist vielmehr die darin enthaltene, versteckte Aussage, dass Fachleute solche Sammlungen gut heißen und dieser Art der Museumspolitik sogar noch frönen, ihre fachspezifische Identität geradezu lieben![3009] Oder ist es einfach nur der Mangel an genügend qualifiziertem Personal und finanziellen Ressourcen, die ein „Öffnen des Museums” nicht oder nur schwer zulassen?
95 % der Bevölkerung sind „Non-Visitors”, das heißt sie gehen nicht in Museen, weil sie oftmals mit dem, was die Museumsleute und Wissenschafter nach bestem Wissen und Gewissen bewahren und anbieten, nichts oder nicht viel anfangen können. Dieter Bogner glaubt – wie er in seinem Vortrag am Steirischen Museumstag 2001 betonte -, dass die Identitätskrise der Museen in dieser Diskrepanz zwischen der so genannten „Fachcommunity” und der „Besuchercommunity” liegt.[3010]
Es sollte daher immer berücksichtigt werden, dass sich das Museumspublikum aus verschiedenen Schichten mit unterschiedlichem Niveau zusammensetzt und die Kommunikation der Museen mit den Besuchern nicht zu stark auf ein bestimmtes Niveau konzentriert werden darf. Geschieht dies nämlich, könnte den Besuchern die Aussage des Museums unklar werden. Viele der traditionellen Ausstellungstechniken, die man – teils immer noch – in vielen unserer Museen antrifft, müssen mit größter Sorgfalt und viel Feingefühl behandelt werden. Sie haben sich zu einer Zeit etabliert, als die Museen eine andere Rolle als heute spielten. Die Zeiten haben sich geändert, die Besucher ändern sich und die Sonderstellung, die Museen im gesamten Bildungsspektrum einnehmen, hat sich ebenfalls geändert. Wenn Museen nicht bereit sind, sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen und sich einzufügen, werden sie die Erwartungen nicht erfüllen können.
Tourismusexperten können uns heute aufgrund von Studien genau sagen, was man der Bevölkerung bieten muss, um Museumsbesucher zu gewinnen und sie zum Wiederkommen zu bewegen – sie sprechen von einer Bedürfnis-Pyramide.[3011] Zunächst ist ein attraktives Angebot Voraussetzung, bei dem die Werbung eine große Rolle spielt, die aber nur richtig funktionieren wird, wenn sich das einzelne Museum am Markt positionieren, eine so genannte „Alleinstellung” sichern und eine „Nische” finden kann, was wiederum eine genaue und ehrliche Analyse der tatsächlichen Möglichkeiten verlangt. Eine Basisaufgabe für Museen in Bezug auf Besucher ist die Befriedigung der Bedürfnisse, zum Beispiel saubere sanitäre Anlagen – überhaupt Sauberkeit im gesamten Museumsbereich -, Ehrlichkeit gegenüber dem Besucher (hält das Museum das, was es im Prospekt verspricht?), gute Beschilderung usw. – alles, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Auf der nächsten Ebene haben die Touristiker die Erwartungshaltung der Besucher angesiedelt, die die Zufriedenheit auslösen soll: zusätzliche Angebote wie Sonderführungen, spezielle Veranstaltungen, Möglichkeiten für Einkauf (Museumsladen) und Gastronomie oder Hinweise über Angebote aus der näheren Umgebung. Top ist das Museum im wahrsten Sinn des Wortes, wenn es die Träume – an der Spitze der Pyramide stehend – erfüllen kann, wenn der Besucher mit Begeisterung weggeht und sicher wiederkommen und das Museum weiterempfehlen will. Dies kann erreicht werden durch besondere persönliche Betreuung, durch Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, tolle Ausstellungsdidaktik und Aussagekraft der Objekte oder Inszenierung, durch besondere Kinder- und Familieneinrichtungen, durch nicht erwartetes Ambiente.
Fazit: Eines können sich Museen nicht leisten: und zwar den Absichten des Museums entgegengesetzte Eindrücke und Gefühle im Besucher hervorrufen. Daher sollten die Museumsmacher, die Experten, ihre Sichtweise etwas in den Hintergrund stellen, um Ausstellungen mit den Augen der Besucher sehen zu können.[3012] Voraussetzung dafür sind jedoch Phantasie und die Bereitschaft, herkömmliche Techniken nach modernen Gesichtspunkten anzuwenden, wenn sie die erwünschten Ergebnisse nicht mehr erbringen. Wünschenswert wären auch regelmäßige Gespräche mit den Besuchern, um zu erfahren, welche Eindrücke, Gedanken sie von einem Museumsbesuch mit nach Hause nehmen. Überhaupt bringt eine personale Vermittlung für beide Seiten mehr, da die Möglichkeit des Hinterfragens, des Klärens und Erklärens gegeben ist – eine interaktive Kommunikation kann stattfinden.
Museumspädagogik darf nicht ausschließlich als nachträgliche Aktivität zur Aktualisierung didaktisch mangelhaft aufgebauter Ausstellungen gesehen werden, die somit das pädagogische Defizit im Arrangement, in der Inszenierung, ausgleichen soll.[3013] Da es das Museum mit einem vielschichtigen Publikum zu tun hat, kann und darf es sich nicht auf eine Kategorie konzentrieren, sondern muss möglichst neutral präsentieren und dementsprechend besucherspezifische Zusatzangebote zur Rezeption zur Verfügung stellen, die vom Besucher genutzt oder eben nicht genutzt werden.
Heidi Hense[3014] schrieb Mitte der 1980er Jahre, als die Museumspädagogik in Österreich noch sehr in den Kinderschuhen steckte: „Über spezifische Aneignungsformen im Museum gibt es (nach Prüfung durch die Verf.) keine Daten oder Erhebungen empirischer Art. Aus eigener Erfahrung und Anschauung kann hypothetisch angenommen werden, daß sie vornehmlich sehr individuell, also subjektiv verlaufen. In dem Maße, wie Medien als Vermittlungsinstanzen im Museum verwendet werden, sind potentiell Formen kollektiver Aneignung (jedoch immer noch rezeptiv) gegeben.”
Durch seine Strukturen realisiere das Museum seinen Bildungsauftrag folgendermaßen: Museum als Ritualraum; auf Betrachten, Beschauen und analysierende Reflexion beschränktes Lernverhalten; Selektionswirkung auf das Publikum. Das soll heißen: „Die im Museum üblicherweise gepflegte Rezeption von Produkten eines kreativen Prozesses ist kein kreatives Lernverhalten.” Dem Besucher sei es nur in sehr beschränktem Maß möglich, durch persönliche Wahl von zusätzlichen Informationsträgern wie Kataloge, Diaserien, Bibliotheksbenutzung selbsttätig zu werden, da alle diese Medien die „Fähigkeit im Umgang mit abstrakten kognitiven Aneignungsformen” voraussetzen. Praktische Selbsttätigkeit sei daher – es sei denn bei speziellen Programmen – in ständigen Schausammlungen kaum gegeben. Fördern könnte man eine solche, indem Sitzgelegenheiten vor Exponate gestellt werden, was die Verweildauer vor dem Objekt vielleicht verlängert und die Rezeption eventuell verstärkt. Sitzgruppen mit Tischen für Bücher, Kataloge, Kritikmöglichkeit, Gespräche etc. wären ebenfalls eine Bereicherung für jedes Museum.[3015]
Will das Museum für den Besucher attraktiver werden,
müssen Bezüge zu den aktuellen Lebenszusammenhängen hergestellt werden;
müssen dem Besucher Verarbeitungsmöglichkeiten des Gesehenen, Gehörten oder Gelernten angeboten werden;
muss das Museum mit seinem Selbstverständnis erfahrungsbezogen arbeiten, das heißt es muss an den Erfahrungen und Interessen der Besuchergruppen anknüpfen.[3016]
Diese Anregungen und Forderungen haben nach wie vor Gültigkeit und werden nur allmählich in den Museen realisiert!
Horst Rumpf setzte sich mit diesem Thema – unter dem Titel „Die Gebärde der Besichtigung” – auseinander:[3017] „Es scheint, daß bei der Übereignung und der Aneignung des kulturellen Erbes die Gebärde der Besichtigung in unserer westlichen Zivilisation seit geraumer Zeit eine überragende Bedeutung innehat. Es scheint, daß ein beträchtliches Maß an Kulturarbeit darauf verwendet wird, Objekte und Inhalte der kulturellen Tradition, wie auch, zunehmend, der Natur – besichtigbar zu machen; kein Wunder, die Bereitschaft eines reiselustigen Publikums zu besichtigen, was zur Besichtigung freigegeben und zur Besichtigung zubereitet ist, diese Bereitschaft scheint fast unersättlich. Die Opfer an freier Zeit, an Geld, an Lebenskraft, die in unserer Gesellschaft aufgewendet werden – und zwar freiwillig, ohne äußeren Zwang -, um über die Gebärde der Besichtigung Kontakt mit dem zu bekommen, was der Besichtigung für wert erachtet, als besichtigungswert ausgezeichnet gelten kann, diese Opfer sind schon erstaunlich. ... Für keine Gesellschaft ist es gleichgültig, wie sie mit dem umgeht, woraus die Menschen und die Gruppen ihre Identität gewinnen; woraus sie die Auseinandersetzung mit ihrer Hinfälligkeit und ihren riesigen Wünschen bestreiten – mit ihrer Kultur, ihrer Vergangenheit und ihren Verkörperungen also.
Was bedeutet es, wenn Kultur via Besichtigung einverleibt, vermittelt wird? Was bedeutet es für die Menschen und was für die Inhalte und Objekte? Gibt es Spielräume, gibt es Alternativen, die dem besichtigenden Blick den Rang streitig machen? ... Nachdenken über die Gebärde der Besichtigung also – ... Aber es könnte ja immerhin sein, daß gerade die gutgemeinten Bemühungen, vergangene Realitäten zu konservieren und für jedermann zugänglich zu machen, in komfortabler fachmännischer Ausstattung – es könnte ja sein, daß gerade diese Bemühungen das Vergangene in seinen erhaltenen Spuren vollends zum Verschwinden bringen. ...
Die Gebärde der Besichtigung – sie ist in Gefahr, das zu übersehen und nicht wahrhaben zu wollen, was uns aus der Welt der Toten, der versunkenen Zeiten, des versunkenen Lebens anweht: die Hinfälligkeit, den Verfall. Täusche ich mich in dem Eindruck, daß die besichtigbar gemachten Gegenstände, Räume, Häuser mit allen Mitteln von den Spuren der Hinfälligkeit, der wachsenden Entfernung, des Hinschwindens gereinigt werden? Und verlieren diese Gegenstände paradoxerweise nicht viel von dem, wodurch sie uns ansprechen und faszinieren – ihre Fremde und Ferne, ihr Anderssein. Es gab und gibt ja wohl eine Art konservierende Vergegenwärtigung, die an die merkwürdigen Bräuche erinnert, die Toten aufzuschminken, daß sie wie Lebende aussehen und zu einem Empfang laden. Ähnlich wie sich – vor unser aller Augen – die Natur entzieht und verabschiedet, wenn sie rigoros in den Griff genommen wird, könnte es nicht auch mit der Geschichte passieren, wenn wir sie mit allen Mitteln medialer Vergegenwärtigung und didaktischer Aufbereitung vor unsere besichtigungssüchtigen Augen zerren? Die langsamen Gesten, die leise Sprache, der behutsame Blick, der Verzicht, und auf das Wichtige immer schon hinweisen zu wollen – die Haltung, die nicht schon Bescheid weiß, sondern die Leere erträgt und warten kann, das sind Züge einer Kulturarbeit, die hoffentlich Zukunft hat. Und die aus der Gebärde der Besichtigung eine Gebärde der Aufmerksamkeit und eine Gebärde der Annäherung werden lassen könnte.”
Viele Museumsdirektoren waren lange Zeit der Meinung, dass sie sich Museumspädagogik nicht leisten können, weil sie meinten, zum Ersten zu wenig Personal oder finanzielle Mittel und zum Zweiten zu wenig Platz zu haben. Diese Ansicht resultierte oft aus der Meinung, Museumspädagogik sei ein Extra, etwas vom normalen, alltäglichen Museumsbetrieb Abgekoppeltes. Das ist sie aber nicht und soll sie auch nicht sein (wie eben auch der Museumspädagoge/die Museumspädagogin ein voll integriertes Mitglied unter den FachkollegInnen beziehungsweise MuseumsmitarbeiterInnen sein soll) – höchstens in besonderen Fällen ein Zusatzangebot. Gerade die erlebnis- und aktionsorientierten Angebote und Aktivitäten sind es, die beim Besucher und in der Öffentlichkeit insgesamt Gewicht haben, obwohl immer noch die Höhe der zur Verfügung stehenden Geldmittel, die Größe der Gebäude, der Umfang der Sammlungen, das Personalvolumen und die Besucherzahlen das Ansehen eines Museums auf- oder abwerten. Wobei diese Faktoren nicht wirklich automatisch etwas über die Qualität eines Museums aussagen!
Erfreulicherweise konnte in den hauptamtlich und professionell geführten „Stadt-/Land- Museen” in und außerhalb der Stadt Salzburg (Salzburger Museum Carolino Augusteum mit seinen Filialen, Barockmuseum, Dommuseum, Haus der Natur, Residenzgalerie, Rupertinum, Salzburger Freilichtmuseum Großgmain, Keltenmuseum Hallein, aber auch in den Salzburger Burgen und Schlössern) seit den 1990er Jahren (vereinzelt schon davor) ansteigend MuseumspädagogInnen fix angestellt sowie in einer Reihe von Heimat- beziehungsweise Orts-, Regional- und Fachmuseen auf dem Lande attraktive museumspädagogische Programme etabliert werden.[3018]
Museumspädagogische Programme sollten meines Erachtens immer – so weit wie möglich – in den Schauräumen stattfinden und nicht in Extrazimmer verlegt werden. Sicherlich ist es oft vorteilhaft, Einführungs- und Einleitungsgespräche und Diskussionen in ruhiger Umgebung, also in einem separaten Raum, führen zu können, der auch als Werkraum dienen kann; der Großteil der Zeit soll jedoch unbedingt in den Schauräumen bei den Sammlungen und Exponaten verbracht werden. Das hat seine besonderen Gründe: Der eigentliche Sinn eines Museumsbesuches liegt im Anschauen und Betrachten von Objekten. Sie sind und haben der Bezugspunkt zu bleiben: um sie herum und durch sie werden Fragen aufgeworfen, Meinungen abgegeben und Diskussionen geführt. Auch praktisches Arbeiten kann durchaus in den Ausstellungsräumen stattfinden – eine sinnvolle personale Betreuung von Museumsbesuchern findet selbstverständlich vorzugsweise in Kleingruppen statt; vorher abzuklären ist die Materialfrage und dementsprechend ist Vorsorge zum Schutz der Objekte und des Bodens etc. zu treffen -, denn auch in dieser kreativen Phase ist neben Phantasie trotzdem der Bezug zu den Museums-Exponaten sehr wichtig, der in einem separaten Werkraum abseits der Schauflächen leicht verloren geht, wodurch den Kindern oft ein visueller Anreiz für ihr Selbsttätigwerden fehlt. Wahrscheinlich stehen in einem Extraraum zwar Stühle und Tische zur Verfügung, einzelne Exponate können dort vielleicht genauer betrachtet und in einen weiteren Kontext gestellt werden, und es gibt keine anderen irrelevanten Objekte, die die Blicke und Aufmerksamkeit der Besucher vom eigentlichen Thema ablenken könnten. Jedoch besteht die Gefahr, dass der Aufenthalt im „Museumsklassenzimmer”, zu dem der Extraraum schließlich wird (Museumspädagogik = Schulpädagogik im Museum?) – weil womöglich angenehmer als in den Schauräumen -, länger dauert als der womöglich erst hinterher folgende Rundgang durch das Museum selbst, um das Diskutierte anzuschauen?!
Das Museum kann einen Aufenthaltsraum jedoch auch zu anderen, vielleicht ruhigeren Zwecken anbieten: zum Beispiel als Ort des individuellen Studiums mittels weiterführender Literatur, Detail- und Zusatzinformationen zu Exponaten u.Ä. Auch das gehört zum museumspädagogischen Aufgabenspektrum, wenn man darunter die „museums- und zeitgemäße Vermittlung des Museumsangebotes für das Gesamtpublikum”[3019] versteht. Zusatzangebote dieser Art hängen tatsächlich von der räumlichen Situation eines Museums ab und können vielleicht auch anders – in die Schauräume integriert? – realisiert werden.
Es ist uns allen – hoffentlich – inzwischen klar, dass Museen eine Bildungsfunktion für alle Bevölkerungsschichten und Fachgruppen haben, selbst wenn dies in keinem Kulturleitbild explizit angeführt ist. Museen haben für einen neuen und erweiterten Besucherkreis zu sorgen, der alle Schichten, für die sie da sein wollen, abdecken soll. In diesem Sinn sollen sie sowohl der gesamten Gesellschaft, sozusagen dem „Normalverbraucher”, als auch bestimmten Einzelbesuchern und Gruppen innerhalb dieser Gesellschaft Gelegenheit geben, aktiv in das Museumsgeschehen eingebunden zu werden und die Ziele und Grundsätze des Museums zu unterstützen.[3020] Museen sollten sich bewusst sein, mit ihren Sammlungen ein neues Verständnis zu wecken und in die Öffentlichkeit zu tragen – und zwar durch Forschung, Bildungsarbeit, Dauer- und Sonderausstellungen und andere besondere Aktivitäten. Diese sollten mit den Grundsätzen und den Bildungszielen des Museums übereinstimmen.
Der Bildungsauftrag des Museums ist nach den ICOM-Statuten klar definiert:
Bildung für alle, für alle Gesellschaftsschichten, für Einzelbesucher, für Gruppen
mit oder ohne Vorkenntnisse (Laien, fachlich Interessierte und Experten);
mit spezifischen Bedürfnissen („specific individuals and groups”).
Es ist daher davon auszugehen, dass ein Museum nicht für eine Elite, für Fachleute, sondern für das breite Publikum gedacht ist.
Das Ziel eines jeden Museums ist der Dienst an der Öffentlichkeit, am Besucher, vermutlich mit der Absicht, ein besseres, aufmerksameres und zufriedeneres Publikum aufzubauen.[3021] Daher sollte es sich nach den Bedürfnissen des Besuchers richten. Die Erwartungen des Besuchers an ein Museum sind zweifellos die vielfältigsten – je nach Alter, Bildung, Interesse. Jeder Museumsdirektor wird bemüht sein, so viele verschiedene Arten von Besuchern als möglich anzusprechen.
Die Frage ist bedeutend, aber kaum umfassend zu beantworten. In Deutschland wurden in den letzten 20 Jahren umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, „wieviele Besucher überhaupt in die Museen kommen, über welches Bildungsniveau sie verfügen, aus welchen Gegenden sie stammen, was sie zum Museumsbesuch veranlaßte, welche Kenntnisse sie über das Museum mitbringen, wieviel Zeit sie im Museum verbringen, ob sie alleine oder in Begleitung kommen und vieles andere mehr.”[3022] Trotz dieser größeren Umfragen ist nach wie vor sehr wenig bekannt über Interesse und Verhalten der Museumsbesucher, Besuchsmotivation, Perzeptions- und Rezeptionsgewohnheiten, das heißt Wahrnehmungsweisen und Aufnahmekapazitäten.
Heiner Treinen[3023] formulierte diskussionswürdige Thesen, wonach die Besucher ein massenmediales Verhalten an den Tag legen, Interessen an expressiver, nicht aber intensiver Rezeptionsweise hätten, eine rasche Abwechslung, aber keine Vertiefung bevorzugten und vor allem geschmacks-, nicht aber inhaltsorientiert seien, und daher sei – entsprechend den Massenmedien – eine Veränderung in Einstellung und Verhalten der Besucher allenfalls im Nachhinein, in der Verarbeitung des Museumsbesuchs beim Basisgruppenprozess, festzustellen.[3024]
Treinen unterscheidet drei Besucherkategorien:
die Kategorie der wissenschaftlich an Sammlungen interessierten Benutzer;
die Kategorie der beruflich auf Museen angewiesenen Benutzer (Kunsthandwerker, Maler, Kunstreproduzenten usw.);
die Kategorie der expressiven Benutzer; damit meint er diejenigen, die am entstehenden bürgerlichen Bildungssystem teilhaben. Diese Klassifizierung der Besucher bezieht sich nicht auf die Motivation von Benutzern, sondern auf die Art des strukturellen Interesses an ausgestellten Objekten.[3025]
Über Anzahl und Motivation der Besucher lässt sich wirklich nur anhand spezifischer Untersuchungen und gezielter Befragungen eine repräsentative Aussage machen. Sehr häufig hängen Besucherzahlen nämlich vom Standort der Museen ab und nicht von der Qualität ihrer Sammlungen und deren Präsentationsform. Ein entscheidendes Kriterium ist für den Großteil des Publikums, vor allem der Einzelbesucher (weniger für Schulklassen und nur zum Teil für andere Gruppen), die Freiwilligkeit, weil hierbei ein – zwar nicht extra artikuliertes – Interesse, eine Neugier, vielleicht auch die Bereitwilligkeit zur Aktivität, zum Selbsttätigwerden vorausgesetzt oder zumindest erwartet werden darf.
Die Museumsbesucher gehören prinzipiell allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten an und sind unterschiedlicher geographischer und sozialer Herkunft. Es ist wichtig, sich dies bei der Vermittlung von Inhalten bewusst zu machen. Es hängt mit den unterschiedlichen Vorerfahrungen zusammen, die Senioren und Schüler, FachkollegInnen und Laien, handwerklich und künstlerisch geschulte und akademisch gebildete Besucher mitbringen oder eben nicht.
Der Besucher will sicher in erster Linie etwas sehen, vielleicht auch etwas hören oder tasten oder riechen – einfach etwas erleben. Vielleicht sucht er nur Unterhaltung und Abwechslung wie bei einem Schaufensterbummel; vielleicht erfreut er sich bloß an alten Objekten oder ästhetischen Kunstwerken oder ...
„Vielleicht will er aber mehr: etwas herausfinden, etwas erkennen und lernen, sich an Schönem freuen, sich von Rätselhaftem anrühren lassen, sich der Faszination durch das Original aussetzen ... Und vielleicht – vielleicht weiß er noch gar nicht, daß ihm dergleichen im Museum begegnen könnte. Vielleicht kommt er einfach aus Neugier, ohne Vorkenntnisse und -urteile, unbefangen und naiv, aber offen. Vielleicht verläßt er das Haus frustriert und gelangweilt und kehrt niemals wieder. Vielleicht aber – vielleicht (und das hängt nicht zuletzt von der pädagogischen Qualität der Ausstellung und der Informationsvermittlung ab) gehen ihm an irgendeiner Stelle Sinne und Sinn auf. Vielleicht knüpft sich hier der erste Knoten eines Netzes, das keine Ränder hat."[3026] Fassen wir die museumsrelevanten Zielgruppen zusammen:[3027]
Die erwachsenen Einzelbesucher: FachkollegInnen, für die die fachwissenschaftlich fundierte Aufbereitung der Themen gegeben sein muss – man will sich ja schließlich nicht blamieren; der Einzelbesucher mit Allgemeinbildung und prinzipiellem Interesse an Museen beziehungsweise der Museums- und Ausstellungsfetischist, der grundsätzlich kein derartiges Angebot versäumt; der Einzelne, der sich für ein bestimmtes Themengebiet interessiert und daher die jeweiligen Ausstellungen frequentiert; die Gäste, die auf die Kulturentwicklung des Urlaubsgebietes neugierig sind oder das lokale/regionale Museum nur besuchen, weil sie einen Tag Pause vom Sonnenliegen oder Schifahren einschalten möchten/müssen – hier ist auf die Bereitstellung von fremdsprachiger Information zu achten.
Die organisierten Erwachsenengruppen: Sie stellen einen großen Besucherkreis dar; sie kommen im Rahmen eines Senioren-, Sport- oder Betriebsausfluges oder in Form anderer Reisegruppen und bevorzugen meistens Führungen, die sehr oft von der Ausstrahlung und dem Wissen des Führenden abhängen und entscheidend sind, ob ein Museumsbesuch zum Erlebnis wird.
Die Interessierten aus der Region: Sie kehren immer wieder, daher ist für Abwechslung durch Sonderausstellungen, Spezialführungen zu ausgewählten Themen und zusätzlichen Veranstaltungen im Museum zu sorgen.
Die Familien: Für sie sollte eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden, in der sich Erwachsene und Kinder gemeinsam wohl fühlen und gleichzeitig etwas erfahren können, zum Beispiel durch Suchspiele, Objekte zum Angreifen und Ausprobieren oder Juniorkataloge.
Die Schulklassen: Sie stellen eine besondere Kategorie dar. Sie sind einerseits eine homogene Gruppe, bei der sich die einzelnen Personen untereinander mehr oder weniger gut kennen und einschätzen können, alle einer Altersstufe angehören, der Lehrer seine Schüler mit Namen ansprechen kann, die lernorientiert ist und dankbar für interessante Alternativen zur Schule. Andererseits kann man hier kaum von einem freiwilligen Museumsbesuch sprechen, da anzunehmen ist, dass der Lehrer über diesen entscheidet, ohne die Schüler einzubeziehen. Es ist also schon vorher eine spezifische Gruppendynamik gegeben, die Lernprozesse beeinflussen beziehungsweise das (Lern-)Verhalten im Museum positiv oder negativ prägen kann. Vom Lehrer hängt es maßgeblich ab, mit welcher Einstellung SchülerInnen ins Museum gehen, mit welcher Freude, Neugier oder Ablehnung sie ein museumspädagogisches Programm erwarten und annehmen oder nicht. Daher ist anzuraten, Programme für Schulklassen in Zusammenarbeit mit LehrerInnen zu entwickeln. Ungelenkte Schulklassenbesuche im Museum können für alle Beteiligten eine Katastrophe sein, meint Magda Krön aus ihrer Erfahrung. „Für die Kinder, weil sie sich langweilen, für die Lehrer, weil sie sich hilflos fühlen und es auch sind und vor allem für das Museum, weil es die Chance verpasst, neue Museumsfans zu gewinnen.”[3028]
Es gab in Frankreich ein Projekt mit 14-jährigen Schülern in Zusammenarbeit mit einer Redaktion, bei dem folgende Ergebnisse an Erfahrungen und Gedanken mit und über Museen herauskamen.[3029] Die Jugendlichen besuchten zahlreiche Museen in Paris und Umgebung und kamen zu dem Schluss, dass es viel interessanter war, sie zusammen mit ein paar Freunden zu besichtigen als mit der ganzen Klasse und dem Lehrer, so dass sie beschlossen, sich bald wieder zu so einer Museumstour zu treffen, weil sie gar nicht alles auf einmal aufnehmen konnten.
Die Jugendlichen waren zum Beispiel sehr fasziniert vom Besuch eines Weinmuseums, in dem sie die Entwicklung und die Veränderungen des Weinanbaus über Jahrzehnte auf höchst interessante Weise vermittelt bekamen. Sie erzählten auch, dass sie beinahe die einzigen Besucher waren, dies aber genossen. In einem anderen sehr kleinen Museum waren die jugendlichen Besucher beeindruckt, weil das Museum vollkommen ohne finanzielle Unterstützung aufgebaut worden war und sie erfuhren, dass dies einzig und allein einem engagierten Ehepaar, das die Bräuche und Traditionen der Region von Touraine und Anjou erhalten wollten, zu verdanken war.
Gründe, warum Museen Kindern und Jugendlichen (und vielleicht auch Erwachsenen) vordergründig eher uninteressant und als keine attraktiven Orte für den Zeitvertreib erscheinen, wurden von den Jugendlichen ebenfalls untersucht und sind im Folgenden zusammengefasst:
Ein Klassenbesuch ist aufgezwungen und daher eher mühsam als interessant; die Schüler können selten selbst ein Museum auswählen; der Lehrer will seinen Unterricht damit verlebendigen, sei aber kaum fähig, die Schüler für sein gewähltes Gebiet zu begeistern, bei hohen Schülerzahlen schwindet die Konzentration äußerst schnell.
Ein öder Museumsbesuch mit der Klasse animiere die Jugendlichen nicht gerade, mit ihren Freunden an einem Wochenende wiederzukehren; sie wissen mit ihrer Freizeit Besseres anzufangen; ein Museum könne man immer besuchen, zum Beispiel wenn einem langweilig ist oder es regnet; wenn der bestimmte Tag aber gekommen ist, an dem man sich den Museumsbesuch vorgenommen hat, könne es vorkommen, dass einem der Sinn dann doch nach etwas anderem steht oder man gar nichts unternimmt.
Museumsbesuche seien außerdem nicht „in” und das schon lange nicht mehr.
Die Kosten-Vergnügen-Rechnung gehe nicht auf (ein Museumsbesuch koste zu viel in Relation zum Vergnügen).
Museen seien oft altmodisch, verstaubt, steif, starr und unheimlich öde.
Die Räume seien oft voll gestopft mit Objekten, noch dazu mangelhaft präsentiert, so dass sie kaum die Aufmerksamkeit des Besuchers erregen; die Beschriftungstexte müssten verständlicher sein.
Genauso steif und starr wie die Exponate seien oft auch die Aufseher; sie tadeln höchstens, geben aber keine Auskunft.
Museumsführer der alten Schule rasseln oder leiern ihre Führung meist herunter wie eine Langspielplatte.
Es gibt zu wenig Information über die weniger prominenten Museen und ihre Bestände (wahrscheinlich gibt es zu wenig oder kein Budget für Öffentlichkeitsarbeit); man müsse sich einen Museumsführer in Buchform kaufen, um auf die Vielfalt der Museen aufmerksam zu werden (wie die Schüler bei diesem Projekt).
Museen seien allgemein zu wenig stark in den Medien vertreten (in Zeitungen seien die wöchentlichen Film-, Konzert- und Theaterangebote ständig zu finden, hingegen viel seltener Museen und Ausstellungen).
Oft könnte schon ein Namenswechsel Anlass für mehr Besucherinteresse sein (zum Beispiel: Kriminalmuseum statt Polizeiarchiv-Museum).
Museumswerbeplakate in Schulen, die regelmäßig auf den aktuellen Stand gebracht werden;
Verteilen von Prospekten in Schulklassen;
Einschaltungen in Rundfunk und Fernsehen zur Hauptsendezeit zwischen Spots für Waschmittel und Wegwerfwindel;
Inserate in Jugendzeitschriften, Fernsehprogrammen, Einschaltungen bei unabhängigen Sendern;
Ermäßigungen bei den Eintrittskarten als besonderer Anreiz zum mehrmaligen Besuch eines Museums.
Es gibt also viele Ansatzpunkte, Museen für Kinder und Jugendliche – die künftigen erwachsenen Museumsbesucher und Multiplikatoren! – attraktiver zu machen und ihnen diese Angebote auch mitzuteilen! Außerdem sollte ein Museums- oder Ausstellungsbesuch nicht nur auf den Lehrstoff bezogen sein, sondern auch zusätzlich und völlig unabhängig vom Lehrstoff ermöglicht werden, da er sicherlich eine Bereicherung und abwechslungsreiche Beschäftigung für Schüler und Lehrer darstellt und zur umfassenden Bildung, die ja in unserem Schulsystem bestmöglich angestrebt wird, beiträgt – daher auch von den zuständigen Stellen (zum Beispiel im Landesschulrat) befürwortet und unterstützt werden sollte.
Grundsätzlich ist es für Museen vorteilhaft, fächerübergreifend zu arbeiten, das heißt Informationen für zusätzliche, zum Museumsbesuch passende Aktionen und Lehrausgänge vorzubereiten, um im Museum thematisierte Inhalte zu verdeutlichen und noch besser veranschaulichen zu können. Eine Erfolgs- und Leistungskontrolle durch Zensuren soll es im Museum nicht geben. Und es schadet auch nicht, vor den Schülern gerade darauf hinzuweisen; bei einigen fällt dann der Leistungsdruck ab und sie sind eher motiviert, sich aktiv an Diskussionen und Denkprozessen zu beteiligen ohne Angst, etwas „Falsches” zu sagen.
Das Verhältnis Schule/Museum beziehungsweise Schulklasse/Museum wird – wie auch Siegfried Rietschel[3030] meint – vom Verhältnis Lehrer/Museum und häufig durch das Einzelverhalten der Lehrer bestimmt. Lehrer sollten daher verstärkt den Kontakt mit Museen zum Ziele konstruktiver Zusammenarbeit suchen. „Aus dem Selbstverständnis ihrer allgemeinen Aufgaben”, so Rietschel, „sind die Museumsmitarbeiter zum überwiegenden Teil an einer guten Zusammenarbeit mit den Schulen und einzelnen Lehrern interessiert.” Eine solche kann aber nur gut funktionieren, wenn man davon abgeht, den Museumsbesuch ausschließlich als Freizeitprogramm vor den Ferien oder als Ad-hoc-Wandertag-Ersatzprogramm bei Schlechtwetter zu sehen. Bei allen Überlegungen darf allerdings nicht übersehen werden, dass Schulklassen nur eine von mehreren Kategorien des Museumspublikums ausmachen.
Eine bislang stark vernachlässigte Besuchergruppe ist die der Menschen mit Behinderungen. Auf deren Bedürfnisse wird in den meisten Museen nur oberflächlich oder überhaupt nicht eingegangen. Was nutzen Rollstuhlrampen am Eingangsportal, wenn die für den jeweiligen Besucher interessanten Themen womöglich erst im zweiten oder dritten Obergeschoss ausgestellt sind? Wie sollen blinde Besucher sich die Geschichte(n) im Museum ertasten, wenn sich ein Großteil der Objekte in Vitrinen befindet? Ein Projekttag mit zwei blinden Burschen und ihren Betreuungslehrern im Museum im Einlegerhaus in Obertrum zum Beispiel zeigte, dass gut ausgewählte Exponate, die frei stehen, und gezielte Information zu den einzelnen Objekten einen großartigen bleibenden Eindruck hinterlassen! Museen sollten daher Kontakt zu Behindertenorganisationen (Betreuer von Behinderten) suchen. Aus dieser Zusammenarbeit könnte ein neues, interessiertes Besucherfeld erschlossen werden.
Im Museum können Freizeit, Erholung und Bildung miteinander verschmelzen. Jeder einzelne Besucher bringt seine eigenen positiven wie negativen Interessen, Kenntnisse, Einstellungen, Anschauungen, Erwartungen und Fähigkeiten (wie Ausdauer, Geduld, Einfühlungsvermögen beim Betrachten, ebenso Aufnehmen qualitativer und quantitativer Reize) mit, aber auch ein gewisses Maß an Neugier und Bereitschaft, Empfänglichkeit für Neues, Fremdes.[3031] Entsprechend seinen Neigungen wird der jeweilige Besucher ein bestimmtes Verhalten im Museum an den Tag legen, wird von den möglicherweise zusätzlich zur permanenten Präsentation vorhandenen Bildungs- beziehungsweise Vermittlungsangeboten Gebrauch machen oder auch nicht, wird das Museum als Ort der Entspannung, des Vergnügens oder Staunens nutzen und die Erfahrung Museum als Lernort – wenn überhaupt – nur indirekt oder unbewusst machen.
Um auf besondere Interessen einzelner Besucher(schichten) eingehen zu können, sind verschiedene Vermittlungsstrategien notwendig, die meist zusätzliches Personal erfordern und daher nicht an jedem Museum angewandt werden können (Personal-, Platz-, Budgetknappheit). Vor allem die häufig ehrenamtlich betreuten Lokal- und Regionalmuseen sehen sich durch ihre eingeschränkten Mittel kaum in der Lage, neben Sammeln, Bewahren und Ausstellen im Sinne von Zur-Schau-Stellen, gezieltes Präsentieren und Vermitteln ihrer Kulturgüter zu bewerkstelligen. Doch gerade die Museen in der Provinz haben die Möglichkeit, „sich als aktives Medium gegenüber den heutigen technisierten Einrichtungen zu etablieren und zwar vor allem bezogen auf ihr unmittelbares Umfeld, ihre regionale Umgebung.”[3032] Gemeint ist damit, dass in den Regional-, Lokal- und Heimatmuseen die unmittelbare Vergangenheit der Region und deren Bewohner durch authentische Objekte – die durch ihre lokale oder regionale Herkunft oft auch Träger individueller persönlicher Erinnerung sein können – dokumentiert ist, dass daher die Verbundenheit mit der Bevölkerung des sie umgebenden Raumes vorhanden ist und das Museum so zu einem Vermittler regionaler Identität werden kann.
Orts-, Regional- und Fachmuseen haben aber auch die Möglichkeit, ihre Relevanz für Entwicklungen der Zukunft unter Beweis zu stellen, indem sie gerade in Zeiten eines zunehmenden Ökologiebewusstseins durch längst überkommen geglaubte Arbeitstechniken und Gerätschaften, die im Zuge einer unbedingten Fortschritts- und Technikgläubigkeit inzwischen „verlernt” und „abgelegt” wurden, Denkanstöße und Vorlagen für eventuelle zukünftige Umstrukturierungen in diversen Lebens- und Arbeitsbereichen bieten können. Reanimierung von verschwindendem Handwerk, Selbstbau von Geräten, Wiedergewinnung von Unabhängigkeit durch eigenständige Entwicklung und Weiterentwicklung von Arbeitshilfen, Erhaltung von Lebensraum durch umweltbewusste Produktionsformen sind längst zu Schlagwörtern geworden. Kulturhistorische Museumsbestände bieten dazu Denkanstöße und Vorlagen, ohne dass gleich an technischen Rückschritt gedacht werden muss.[3033]
Je breiter das Vermittlungsangebot gefächert ist, umso größer wird die Zahl der Anknüpfungspunkte und damit das Interesse und die Identifikationsmöglichkeiten der Museumsbesucher sein, so sie mit einer solchen Absicht in das Museum gehen. Den einheimischen Besuchern bieten kulturgeschichtliche Museen die Möglichkeit, die eigene Geschichte beziehungsweise Kulturgeschichte des Heimatortes, der Heimatstadt, der Heimatgemeinde oder der ganzen vertrauten Region sinnlich und anschaulich erfahrbar zu machen. Viele Exponate entstammen dem täglichen Lebens- und Arbeitsbereich und können dadurch identitätsstiftend oder beziehungsfördernd (zwischen Museumsobjekt und Besucher) wirken. Der Wiedererkennungseffekt spielt bei diesem Zugang zum Museum und dessen Exponaten also eine wesentliche Rolle. Vertrautes/Bekanntes muss einen Museumsbesuch nicht langweilig werden lassen, sind die Themen und Objekte ansprechend aufbereitet und präsentiert.
Eine andere Gefühlsebene – Neugier-Effekt und Aha-Erlebnis – kann vor allem bei jungen Menschen, bei Besuchern aus dem städtischen Bereich und bei Touristen aus dem In- und Ausland angesprochen werden. Angesichts ausgestellter Kunst-, Lebens- und Arbeitsbereiche anderer Menschen und Kulturen, vielleicht sogar Kulturkreise, können neue Gefühlserfahrungen – vom anfänglichen Unverständnis bis hin zum Vertrautwerden und Würdigen des „Fremden” – gemacht werden. Gleichzeitig kann der Gast detailliert Eindrücke zu einem bestimmten Themenbereich gewinnen, sich aber auch – vor allem mit der Einrichtung von Spezialmuseen mit lokalen oder regionalen Schwerpunkten – durch den Besuch diverser Museen einen (in die Tiefe gehenden) Überblick über die Errungenschaften eines begrenzten regionalen Raumes verschaffen.
Kindern und Jugendlichen bietet sich im Regionalmuseum vor allem die Möglichkeit, Themen, die ihre unmittelbare Lebenswelt betreffen, kennen zu lernen und aufzuarbeiten. Ein Verständnis für Volkskunde, Geschichte und Kulturgeschichte kann in ihnen geweckt und gefördert sowie Entwicklungen und Zusammenhänge zwischen Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem erläutert und klar(er) gemacht werden. Die Museumsobjekte stellen dabei nicht nur wichtige dreidimensionale Anschauungshilfen dar, die regionale Kulturgeschichte erfahrbar und be-greifbar machen, sondern sie sind Ausgangsbasis und Mittelpunkt für die Vermittlung.
Museen beherbergen meist eine Fülle von Exponaten, durch die nicht selten der Fall auftritt, dass Besucher – sowohl Erwachsene als auch Kinder – nach einiger Zeit mit vermutlich aus Konzentrationsschwäche resultierendem Desinteresse und Langeweile reagieren, weil sie mit Informationen und Aha-Erlebnissen geradezu bombardiert werden und dieser Konfrontation in der Folge nicht standhalten können. Daher ist es nötig, die Bestände nach Themen und speziellen Schwerpunkten für die Jugend aufzubereiten.
Das Museum kann – nein, muss – dabei die Originalität, Dreidimensionalität und Authentizität der Objekte nutzen und sie in bestmöglicher, aussagekräftiger Form präsentieren. Gegenstände in kulturgeschichtlichen Museen (die meisten Heimat- beziehungsweise Orts-, Regional- und Fachmuseen fallen darunter – im Gegensatz zu den Kunstmuseen) sind hauptsächlich Originale, denen häufig eine bestimmte Funktion und bestimmte Information anhaftet. Falls diese Objekte nicht für sich selbst sprechen, die Information also nicht für alle entschlüsselbar ist und der Besucher ratlos im Museum steht, bedarf es der „Übersetzung” mit Hilfe unterschiedlicher didaktischer Methoden.
Die Museums- und AusstellungsmacherInnen und/oder die VermittlerInnen haben hierbei die Aufgabe, in der Gestaltung des Museums oder der Ausstellung darauf zu achten, Exponate des Hauses beziehungsweise deren „Aussage” an die Besucher zu vermitteln, im Besucher Neugier zu wecken und Zusammenhänge deutlich zu machen. Das beinhaltet auch, durch zusätzliche Angebote in schriftlicher, personaler oder anderer medialer Form entsprechende Informationen für den Besucher bereitzuhalten, um die vorher geweckte Neugier des Besuchers auch einigermaßen stillen zu können.
Abschließend sei ein Kurzüberblick über Vermittlungsformen im Museum gegeben, die Kommunikation zwischen Besucher und Objekt herstellen können. Diese museumsdidaktischen und museumspädagogischen Maßnahmen beginnen bereits bei der Ausstellung und richten sich an ALLE Museumsbesucher (Kinder UND Erwachsene). Wenn auch die Öffentlichkeitsarbeit mit einer ansprechenden Prospektgestaltung, Beschilderung etc. dazu zu zählen ist, so sollen im Folgenden doch in erster Linie die Kommunikationsformen IM Museum angesprochen werden.[3034]
Einige Grundsätze zur Vermittlung sind:
Prinzip: Erfahren-Erforschen-Erleben oder Hirn-Hand-Herz!;
Weniger ist mehr;
Das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen;
Herausfiltern, was der Besucher wirklich wissen muss;
Besucher sind zum Großteil Laien und keine Fachwissenschafter;
Originalität, Dreidimensionalität und Authentizität der Objekte nutzen!;
Alle Sinne ansprechen! Sinn und Sinnlichkeit! Atmosphäre schaffen!;
Eigenaktivität wecken und fördern;
Entdeckungsfreude ausnutzen;
Schaulust befriedigen (Farbe, Material, Beleuchtung, Hintergrund);
Abwechslung schaffen.
durch die Art der Präsentation, durch die Raumgestaltung (meist für die Einzelbesucher) und
durch zusätzliche Angebote für bestimmte Zielgruppen (meist für Gruppen jeglicher Art).
Permanente Schausammlung (Dauerausstellung): Mit der Präsentation der Inhalte, das heißt mit der Konzeption der Schausammlung als permanente Ausstellung, wird zunächst das Ziel verfolgt, dem Museumspublikum – und damit ist keine bestimmte Zielgruppe gemeint, sondern alle potentiellen Besucher undifferenziert nach Alter, Bildung und sozialer Herkunft – die Exponate des Museums als Träger von Botschaften, als authentische dreidimensionale historische Dokumente näher zu bringen, sie in einen sozialgeschichtlichen Kontext zu setzen. Das heißt Auswahl bei der Konzeption der Dauerausstellung: Welche Objekte sollen präsentiert, wie sollen sie aufgestellt und angeordnet, beleuchtet und beschriftet werden? Wissenschaftliche (Wert und Ästhetik der Objekte) und konservatorische (Altersschäden, Brüchigkeit, Licht- und Temperaturempfindlichkeit, Berührungsresistenz) Überlegungen spielen dabei eine wesentliche Rolle, aber auch didaktische/pädagogische vor allem in Bezug auf die Beschriftung: Die Relation zwischen Umfang und Absatz eines Kataloges, Schilder neben den Exponaten, Tafeln zu ganzen Objektgruppen, Informationsblätter zum Mitnehmen etc., Schriftgrad und Schriftgröße bei gedruckten Informationen, Formulierung und Stil des Geschriebenen, Verwendung von Fachtermini und vieles mehr sind zu berücksichtigen.
Die Schausammlung muss also für alle potentiellen Zielgruppen konzipiert und aufbereitet sein, da sie die ständige Erscheinungsform des Museums darstellt, in der sich der Besucher entsprechend seinen Neigungen all das oder zumindest einen Aspekt heraussuchen können sollte, von dem er etwas für sich gewinnen möchte. Das impliziert auch, dass er beim Besuch der permanenten Sammlung ohne personale Vermittlung seine Verweildauer selbst bestimmen kann. Jeder kann das Museum wieder verlassen, wann er will. Jeder kennt seine Grenzen, innerhalb derer er fähig ist, aufzunehmen. Gerade der Sättigungspunkt wird bei jedem anders gelagert sein und ist bei einiger Erfahrung vor allem bei Führungen von Gruppen (Erwachsenen wie Schülern) deutlich erkennbar. Außerdem wird man nie prüfen können, ob der Besucher etwas „gelernt” hat oder nicht, ob er etwas aus dem Museum für sich mitgenommen hat oder nicht. Das Lern- oder Bildungsziel im Museum ist nicht überprüfbar. Viele Besucher waren einfach im Museum (Punkt). Die angebotene Information wird also immer nur eine begrenzte Anzahl von Adressaten erreichen, bei denen dafür aber vielleicht mehr auslösen als nur einen kognitiven Prozess.
Temporäre Ausstellung (Wechselausstellung, Wander-, saisonale Ausstellung): Ermöglicht die Präsentation von Sammlungen/Themen aus dem Depot und dadurch eine strukturierte und vertiefte Darstellung eines Sachgebiets, wobei neue Ausstellungstechniken eingesetzt werden können. Sonderform: Rollende Ausstellung (zum Beispiel Museumsbus). Motto: Das Museum kommt zu den Besuchern; werbewirksam, aber kostenaufwändig (Konzeption, Umsetzung, Wartung, Chauffeur, Organisation der Zielorte).
Texte/Beschriftungen: Informative, wissenschaftlich einwandfreie, anregende und lesbare Hintergrundinformation mittels Raum-/Übersichts-/Bereichstexten (auf Tafeln, Fahnen, Transparentplatten usw.) und sinnvoller Objektbeschriftung (was? wozu? wofür?; genaue Datierungen sind dem Fachwissenschafter wichtig, runde Jahreszahlen dem Publikum – es wird es Ihnen danken!).
Saalzettel (eventuell zum Sammeln in einer Infomappe) sind unterstützend bei der Museumsbetrachtung, bieten Hintergrundinformation; sie sind ein geeignetes Medium für fremdsprachige Information!
Kataloge, Broschüren, Bücher sind weiterführende und informativ vertiefende Vermittlungsmedien; entweder zum Nachschlagen, Nachlesen und Nachdenken; meist nach dem Museumsbesuch (dann kaum Kommunikationsträger!) oder als Führer durch Sammlungen während des Museumsbesuches.
Kinder-/Juniorkatalog: Führer durch die Ausstellung mit Suchspielen und anderen gemeinsam (zum Beispiel mit den Eltern, Großeltern oder FreundInnen) zu lösenden Aufgaben.
Erkundungsbögen können Denkanstöße bei der Museumsbetrachtung liefern.
Arbeitsblätter, Suchspiele, Quiz: Didaktisch aufbereitete Unterlagen für bestimmte Zielgruppen, mit kognitivem Schwerpunkt; enthalten Wissensfragen, Suchaufgaben, Bewertungsfragen, Zusatzinformationen, erläuternde Zusammenhänge; mehr oder weniger Betreuung erforderlich. Vorteil: Raum für eigenes Schauen, Gruppenarbeit und Eigenaktivität möglich, Auseinandersetzung wird gefördert. Gefahren: Fixierung auf das Ausfüllen und Nichterkennen der Möglichkeit der Eigenaktivität.
Führung: Häufigste Art der personalen Vermittlung; frontal oder gesprächsorientiert; eventuell themenorientierte Schwerpunktführungen; Auswahl- und Entscheidungsaufgaben als Basis für nachfolgende Besprechung oder Führung; Qualität abhängig von Wissen, Schulung und Persönlichkeit des Vermittlers (Führers oder Museumspädagogen) beziehungsweise vom Eingehen auf Bedürfnisse, Meinungen, Beobachtungen und Vorwissen der Besucher; Vorteil: Frage-Antwort-Möglichkeit.
Museumspädagogische Programme mit praktischen Teilen: Sollen eine Verbindung von Führung/Dialog und hohem aktiven praktischen Teil (Zeichnen, Malen, Gestalten, Musizieren, Kochen, Rollenspiel u.Ä.) sein. Grundidee: Die Fülle von Themen, Inhalten und Objekten in Museen portionieren, gliedern und unter einem Schwerpunkt mit den Besuchern erarbeiten. Der kreative Teil muss mit dem Gesehenen, Gehörten, Erfahrenen im Museum/in der Ausstellung in engem Zusammenhang stehen. Bloße Bastelarbeiten um des Tuns willen sind hier nicht gemeint!!!
Museumspädagogische Projekte: Können zum Beispiel mit Schulklassen/Lehrlingen erfolgen; Projektablauf wird gemeinsam entwickelt und teils in der Schule/Lehrlingsausbildung, teils im Museum umgesetzt; auch in der Freizeit möglich, zum Beispiel mehrtägige Ferienprogramme: Arbeiten an historischen Originalschauplätzen in Verbindung mit dem örtlichen/regionalen Museum; enger Bezug zu den Museumsexponaten erforderlich!
„Packages”: Anbieten von Programmen im Museum in Verbindung mit dem Umland; zum Beispiel Themenführung oder museumspädagogisches Programm mit Exkursion zu historischen Originalschauplätzen oder lebendigen Stätten wie Bauernhöfe, Fabriken oder Ähnliches.
Gute Vermittlung von Geschichte und Vermittlung überhaupt in Museen basiert auf sinnvollen Fragestellungen, auf die das Museum, aber auch der Besucher Antworten finden können sollte. „Neugierig machen basiert auf der Wechselbeziehung zwischen interessanten Fragen und spannenden Antworten. Fragen und Antworten sind Grundlage von Kommunikation ... Die Frage motiviert dazu, daß man selber einmal, bevor man nachschaut, spontan nachdenkt. Die Frage ist wichtiger als die Antwort. Gehen wir weg vom Behaupten: ‚So war es'.”[3035]
Gib dir selbst klare Leitlinien,
orientiere dich auch am Besucher und nicht nur an den traditionell wichtigen, nicht zu vernachlässigenden wissenschaftlichen Aufgaben,
pflege Rituale und Bräuche, aber reagiere auch auf Zeitgeist und Trends und
mache durch interessante Fragestellungen auf dich und deine unschätzbaren Inhalte aufmerksam.
[2996] „Ein Museum ist eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt. Diese Definition des Begriffs ‚Museum‘ soll ohne jede Einschränkung gelten, jeweils unabhängig von Trägerschaft, territorialem Charakter, Betriebsstruktur oder Ausrichtung der Sammlungen der betreffenden Einrichtung. ...“ – Auszug aus den ICOM-Statuten, die am 5. September 1989 auf der 16. ICOM-Vollversammlung in Den Haag, Niederlande, verabschiedet und am 7. Juli 1995 auf der 18. ICOM-Vollversammlung in Stavanger, Norwegen, sowie am 6. Juli 2001 auf der 20. ICOM-Vollversammlung in Barcelona, Spanien, ergänzt wurden.
[2997] Die folgenden Inhalte sind, wenn nicht anders angegeben, entnommen aus: [Prasch-Bittricher 1994], S. 16ff.
[2999] [Weschenfelder/Zacharias 1988], S. 25f.
[3000] [Clarke 1991]; siehe auch: [Allan 1978].
[3001] In Salzburg ist dieser Typus von Sammlern noch vertreten, die sich als „Technologie-Sammler und Museumsverein“ zu einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen haben.
[3002] [Harrison 1978], S. 82: „Without exception everything that a museum does is educational, even when this is not the intention.“
[3004] Vgl. [Clarke 1991].
[3005] [Weschenfelder/Zacharias 1988], S. 26.
[3006] Zit. nach: [Weschenfelder/Zacharias 1988], S. 26f.
[3007] Vgl. [Allan 1978], S. 25.
[3008] Vgl. [Clarke 1991].
[3009] Vgl. [Clarke 1991], S. 22.
[3011] Vgl. [Vitovec 2002b].
[3012] Vgl. dazu [RumpfH 1990].
[3013] Siehe auch: [Gottmann 1979], S. 32; vgl. [Marte 1990], S. 14: „Eine integrierte und qualifizierte Museumspädagogik ist gleichwertig mit den anderen Funktionen des Museums. Es ist daher nicht ihre Aufgabe, nur das weiterzugeben, was andere ausgedacht haben und fertigen Schausammlungen und Ausstellungen sozusagen ein museumspädagogisches Mäntelchen umzuhängen. ...“
[3014] [Hense 1985], S. 96.
[3015] [Hense 1985], S. 97.
[3016] Siehe: [Hense 1985], S. 99: „Das Museum als neuer Lernort“.
[3017] [RumpfH 1990], S. 9ff.
[3018] Siehe Broschüren zu museumspädagogischen Programmen in Stadt und Land Salzburg, z.B.: [Bittricher/Krön 2001].
[3019] Zit.: [Rietschel 1988], S. 158.
[3021] Vgl. [Allan 1978], S. 24.
[3022] [Nuissl/Paatsch/Schulze 1988], S. 39.
[3024] [Nuissl/Paatsch/Schulze 1988], S. 40.
[3025] [Hense 1985], S. 92: (die Kategorisierung stammt aus dem Jahr 1974).
[3026] [Freymann/Grünewald-Steiger 1988], S. 22.
[3030] [Rietschel 1988], S. 158.
[3031] Vgl. [Freymann/Grünewald-Steiger 1988], S. 21.
[3032] [Prasch-Bittricher/Prasch 1991], S. 3.
[3033] [Prasch-Bittricher/Prasch 1991], S. 4.
[3035] [BognerD 2002], S. 10.