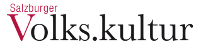

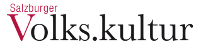

Inhalt des Textes ist der Versuch, von einem persönlichen Standpunkt und einem konkreten Standort aus, Kulturarbeit transparent zu machen. „Persönlicher Standpunkt” umschreibt die Tatsache, dass es der Autor ist, der diese Kulturarbeit (mit)betreibt; „konkreter Standort” meint das (hauptsächliche) Wirkungsfeld des Autors, nämlich den seit 1982 bestehenden Kulturverein Schloss Goldegg, und mit „Kulturarbeit” ist die Veranstaltungstätigkeit gemeint, die – das wird gerne vergessen – konzeptuelle Überlegungen voraussetzt. Aufgrund von zertifizierten Lehrgängen zur Kulturarbeit hat sich in den letzten Jahren der Terminus „Kulturmanagement” respektive „Kulturmanager” durchgesetzt. Doch um in der „Region” Kultur zu managen, ist sehr oft körperlicher Einsatz vonnöten: Sessel sind zu tragen, Tonanlagen aufzubauen, Bühnenelemente her- und wieder wegzuschleppen, also all das, was andernorts von diversen Hilfskräften, dem Bühnen- oder dem Aufbaupersonal geleistet wird. Aus diesem Grund ist es angebracht, anstelle der eleganten und dem wirtschaftlichen Leben entlehnten Formulierung „Manager” vom Kultur-Arbeiter zu sprechen. Charly Rabanser, Leiter des m2-Kulturexpress in Neukirchen wusste dies in einem Interview sehr lapidar zu begründen: „Kulturmanager tragen keine Sessel.”[3039] Somit lässt sich sagen: es geht im folgenden Text um die Kulturarbeit auf dem Land: von den ersten Überlegungen über die konkrete Planung hin zur Umsetzung.
Es geht im Folgenden nicht um die (legitime) Frage, inwiefern man die abstrakten Begriffe „Kunst” und „Kultur” von einander abgrenzen könnte, wie man sie definieren könnte, wer sie definiert etc. Beide Begriffe benennen gesellschaftliche Phänomene, die einem ständigen Wandel unterworfen sind – schon allein diese Tatsache ist für viele Menschen nicht nachvollziehbar, und allzu groß ist der Glaube an das Unveränderliche und der Wunsch, oder die Sehnsucht, nach Beständigkeit und unverrückbaren Gegebenheiten. Lediglich dieser Moment des Prozesshaften sei an dieser Stelle betont.[3040] In unserem Kontext und mit Blick auf den schon strapazierten Begriff „Kulturarbeit” ist das Kulturförderungsgesetz des Landes Salzburg hilfreich, um sich über die „Kultur” Klarheit zu verschaffen. Kultur wird in dem Landesgesetz von 1998 als Überbegriff verstanden. Es heißt im § 2 (4): „Als Bereiche der Kultur sind nach diesem Gesetz die Kunst, die Volks- und Alltagskultur, die Wissenschaft und die Bildung zu fördern.” Kulturarbeit ist somit eine Tätigkeit in einem sehr weit gefassten Rahmen, fast ist man geneigt zu sagen, anything goes. Doch genau dieses „anything” ist der Dreh- und Angelpunkt, die Schnittstelle, naturgemäß auch die heikle Stelle und der wunde Punkt, wenn es um Kulturveranstaltungsprogramme geht.
Wenn von der Region die Rede ist, kann nur jener Bereich gemeint sein, der – bisweilen negativ – mit „Provinz” bezeichnet wird und im Grunde jenes Feld bezeichnet, das nicht mehr der Stadt zugerechnet wird. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um die altbekannte Relation Stadt – Land. Die Stadt markiert jenen Punkt, der aufgrund historischer Fakten und wirtschaftlicher Gegebenheiten eine zentrale Position in jeder Hinsicht – wirtschaftlich, sozial, machtpolitisch etc. – einnimmt. Diese zentrale Position zeigt sich in allen Bereichen, naturgemäß auch in jenen Bereichen, die mit Kunst und Kultur umschrieben werden. Diese Diskrepanz, dieses Missverhältnis zwischen dem städtischen und dem ländlichen Feld ist unumstritten: Kulturlandesrat Othmar Raus spricht unumwunden von der „ressourcenmäßigen Ungleichbehandlung zum ‚kulturellen Wasserkopf' Landeshauptstadt”,[3041] und der gesetzlich verankerte Fachbeirat Kulturinitiativen Land fordert „eine Gleichstellung gegenüber städtischen Kultur- und Kunsteinrichtungen”.[3042]
1967[3043] wird in Zell am See der Kunstverein Galerie Zell am See gegründet, der für sich in Anspruch nehmen darf, Vorreiter zu sein, denn erst in den ausgehenden 70er und beginnenden 80er Jahren kommt es zur eigentlichen Ausprägung einer regionalen Kulturszene im Land Salzburg, zu der mittlerweile mehr als 50 Kulturinitiativen zählen. Einige Initiativen – augrund ihrer inneren Struktur sind es Vereine – konnten sich ein sehr eigenständiges Profil erarbeiten. Diese Kulturinitiativen sind immer von Einzelpersönlichkeiten geprägt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, durch das Setzen von Aktivitäten das kulturelle Stadt-Land-Gefälle zu korrigieren, sozusagen eine „kulturelle Grundversorgung” auch für die ländliche Bevölkerung zu gewährleisten. Theater und Konzerte, Ausstellungen und Festivals ließen sich nur in der Stadt erleben, am Land war das kulturelle Geschehen an der Tradition orientiert, das mit den Schlagworten Brauchtums- und Heimatpflege zwar simplifiziert, aber doch grundsätzlich richtig charakterisiert werden kann. Mit dem Aufkommen von Kulturvereinen wurde diese Differenz aufgebrochen.
So hat es Ernie Gadenstätter, die Leiterin der Galerie Zell am See (die aufgrund ihrer jetzigen Stätte auch Galerie Schloss Rosenberg genannt wird), verstanden, sich in den Jahrzehnten ihres beständigen und kompromisslosen Wirkens einen über die Grenzen Österreichs hinaus reichenden Namen zu machen. Künstler wie Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Günter Brus oder Christian Ludwig Attersee, die heute zu den Klassikern der zeitgenössischen bildenden Kunst zählen, wurden von Beginn ihrer Tätigkeit in regelmäßigen Abständen in Ausstellungen gezeigt, begleitet von Vorträgen, Gesprächen und Begegnungen, die die Rezeption erleichterten.
1971 fanden in Rauris die ersten Rauriser Literaturtage unter Beteiligung von Thomas Bernhard und Peter Handke statt, 1972 wurde erstmals der Literaturpreis vergeben, Bodo Hell war der Preisträger. Wer die Literaturtage besucht, kann aus eigener Erfahrung die unglaubliche Anziehungskraft dieses in den letzten Jahren an einem Thema ausgerichteten „Lesefestivals” bestätigen: die Vorlesungsräumlichkeiten sind bis auf den letzten Platz – nein, hoffnungslos überfüllt, sogar die Vertreter der Medien können sich ihrer Aufgabe nicht entziehen und müssen aufs Land, in den Gebirgsgau. Im Jahr 2000, aus Anlass der 30. Rauriser Literaturtage, wurde eine vielbebilderte Festschrift publiziert, die beweist, dass das anfangs als Experiment bezeichnete Unterfangen, Literatur aufs Land zu tragen, mehr als geglückt ist. Der Beharrlichkeit von Brita Steinwendtner, die seit 1990 die Literaturtage leitet, ist jener Erfolg zu verdanken, den Anton Thuswaldner als „Rauriser Phänomen” bezeichnete: „Dass Lesungen jeden üblichen Rahmen sprengen, ganz gleich wo sie stattfinden, die Räume erweisen sich jedes Mal zu klein.”[3044]
1975 gründete der HS-Lehrer Schneider Josef mit vier Freunden in Altenmarkt den Verein FILMFORUM DAS ANDERE KINO, mit dem Ziel, dem Kinosterben entgegen zu wirken. In Radstadt wurde das bestehende Kino genutzt, die umliegenden Gemeinden „versorgte” ein Wanderkino, ehe man Schloss Höch als Veranstaltungsort entdeckte, das Programm erweiterte und 1977 den Vereinsnamen auf „Forum Anisus” änderte. 1979 wurde zwischen dem Schlosseigentümer und dem Kulturverein ein langfristiger Pachtvertrag abgeschlossen, als Gegenleistung für die Nutzung des Schlosses die Sanierung des Gebäudes durch den Verein und die öffentliche Hand vereinbart. 1984 wurde nach einem mehrjährigem Rechtsstreit mit dem Skifabrikanten Alois Rohrmoser der Verein zur Aufgabe des Pachtvertrages gezwungen – die Kulturarbeit auf Schloss Höch fand damit ein bedauerliches Ende. Die Renovierung des Radstädter Kapuzinerklosters brachte eine Neugründung des Vereins mit sich, der sich seitdem Kulturkreis DAS ZENTRUM nennt. Seit 1998 ist Elisabeth Schneider Obfrau und Geschäftsführerin des Kulturkreises, der sich durch inhaltliche Schwerpunktsetzungen (Paul Hofhaimer-Tage, Kunstzeichen Radstadt, Literaturfestival freies lesen) und eine konsequente Veranstaltungstätigkeit als kulturelles Zentrum in der Region Enns-Pongau etablieren konnte.
Das Zentrum zeitgenössischer Musik unter der Leitung von Gerhard Eder veranstaltete im Jahr 2003 zum 25. Mal das Jazzfestival Saalfelden, eine international bekannte und in der europäischen Jazzszene fest verankerte Veranstaltungsreihe. Nicht einmal schlechtestes Wetter kann verhindern, dass an einem langen Wochenende im August die besten Jazz-Musiker und Freunde des Jazz aus aller Welt anreisen, um Saalfelden für einige Tage zum Nabel der Jazz-Welt zu erklären. Seit Jahren ist das mediale Echo groß und der Publikumsansturm ungebrochen.
In einer so genannten Proponentenversammlung im Jänner 1982 beschlossen einige Goldegger Bürger die Gründung eines Kulturvereines, um das Schloss Goldegg, das für die Landesausstellung des Jahres 1981 revitalisiert worden war, weiter zu nutzen. In den zwanzig Jahren des Bestehens und mit Cyriak Schwaighofer an der Spitze, zuerst als Obmann, dann auch als Geschäftsführer, gelang der Ausbau zum regionalen Kulturzentrum Schloss Goldegg, das durch ein vielfältiges Programm gezeichnet ist und dessen Herzstück die „Goldegger Dialoge” sind. Diese Gesprächsreihe mit dem Motto „Gesundheit ist lernbar” wurde schon im ersten Jahr des Bestehens durchgeführt und seither kontinuierlich fortgesetzt. 2003 lautete der Titel der 22. Goldegger Dialoge „Aus der Egoismusfalle – Selbstfindung zwischen Einsamkeit und Geborgenheit”.
In den ausgehenden 50er Jahren wurde von Künstlern die Alltagsästhetik – die Attraktivität der Konsum- und Medienwelt – entdeckt und für die eigene künstlerische Arbeit ausgewertet. Die internationale Ausbreitung dieses Phänomens war in allen Bereichen gegeben: Film, Mode, Design, Werbung, Musik und Literatur – in allen Kategorien, die man im soziokulturellen Feld einer Gesellschaft findet, setzte sich ausgehend von der bildenden Kunst die so genannte Pop Art durch. Historisch gesehen setzte 1956 die Londoner Ausstellung mit dem bezeichnenden Titel „This is tomorrow” den Auftakt für die Pop Art. Vom britischen Künstler Richard Hamilton war in dieser „Show” eine Collage zu sehen, in der so gut wie alle Bedürfnisse des Konsumlebens abgedeckt werden: in einem wohnzimmerähnlichen Ambiente räkelt sich eine barbusige Dame mit Trockenhaube auf der Couch, das Tonbandgerät im Vordergrund, der Fernseher im Hintergrund und irgendwo dazwischen ein Staubsauger verweisen auf die (vermeintlich) zeitgemäße Ausstattung mit Konsum- bzw. Luxusartikeln; ein in der Mitte des Interieurs posierender Bodybuilder hält in seiner Hand eine Tafel, auf der das Wort POP zu lesen ist. Die Collage selbst ist betitelt mit „Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?” (Was macht eigentlich die heutigen Zuhause so anders, so anziehend?) Dieser kunsthistorische, sich auf die Anfänge der Pop Art und ein berühmtes Werk beziehende Tatbestand ist bekannt. Was aber hat Hamiltons Collage und „This is tomorrow” mit unserem Thema zu tun? Der Grund ist: ein Bild sagt mehr als tausend Worte – die Collage liefert ein Bild, ein Ab-Bild, für die Programmatik des Kulturvereins, und der Ausstellungstitel lässt sich in einer gewissen Weise als die Intention dieses Programmes lesen.
Die Collage ist eine kombinatorische Technik, die immer auf Teile der Wirklichkeit zurückgreift, schon Vorhandenes ist ihr Ausgangsmaterial – vorgegebene Teile werden genommen und neu zusammenstellt. Durch das Ausschneiden werden die Elemente – die Bildteile – aus ihrem Kontext gelöst und gewissermaßen frei für Neues gemacht; das Zerschneiden oder Zurechtschneiden der einmal gefundenen Elemente ist gleichzusetzen mit dem notwendigen Bearbeiten und Modifizieren für den neuen Kontext. Die Technik der Collage veranschaulicht, wie Programme entstehen: nämlich durch Suchen und Finden von Elementen, die im besten Fall ein neues Ganzes ergeben.
Der Titel der Collage „Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?” formuliert einmal mehr auf sehr pointierte Weise jenes Problem, dem man sich als Programmgestalter immer stellen müsste: was ist es, das mein aktuelles Programm anziehend macht und gleichzeitig von anderen Programmen unterscheidet?
„This is tomorrow” – eine selbstbewusste Aussage zu behaupten, man wüsste, wie es morgen ist. Doch in gemilderter Form lässt sich die Affinität dazu nicht leugnen, geht es doch dem Kulturverein Schloss Goldegg (wie anderen Kulturvereinen auch) um den Blick nach vorn, um neue Erfahrungen und Sehweisen, um neue visuelle Erlebnisse und nicht um die Wiederholung des schon Bekannten und Üblichen. „Die meisten leben in den Ruinen ihrer Gewohnheiten”, meinte der französische Dichter, Maler und Filmregisseur Jean Cocteau. Schade, aber allzu wahr; die Ruinen in wohnliche Häuser zu verwandeln sieht der Kulturverein als seine Aufgabe an. Doch was dem einen ruinös erscheint, ist dem anderen immer noch ein behagliches Ambiente, aus dem er sich nicht so ohne weiteres herauslocken lässt.
Die Arbeit des Kulturvereines Schloss Goldegg ruht auf mehreren Säulen, die einmal mehr, einmal weniger zum Tragen kommen. Grundsätzlich versteht sich der Kulturverein Schloss Goldegg als regionales Zentrum, die Kulturarbeit lässt sich mit den praxisorientierten Verben veranstalten, anregen und vermitteln umschreiben – und das in möglichst vielfältiger Weise. Es gehört jedoch zum Selbstverständnis des Vereins, mit einzelnen Projekten über das regionale Wirkungsfeld hinaus zu wirken. Für die Kunst- und Kulturschaffenden der Region will man Podium und Förderer sein, wobei die Begegnung mit nationalen bzw. internationalen Persönlichkeiten des Kulturlebens sowie spartenübergreifende Projekte – Stichwort Cross over – ohne Berührungsängste zu anderen Einrichtungen und Kulturen immer intendiert ist. Damit steuert man dem einen Problem – nur nicht im eigenen Saft braten, könnte man salopp formulieren – entgegen. Das Programm enthält dabei einerseits Veranstaltungen im Sinne einer „kulturellen Grundversorgung” der Region, darüber hinaus regionsbezogene und thematische Projekte, unter anderem zum Jahresthema.
Der andere Problempunkt ist mit dem Schlagwort Beliebigkeit umrissen. Um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, Veranstaltungen wahllos aneinander zu reihen, richtet der Kulturverein seine Veranstaltungen an einem Jahresthema aus. Gaben in den vergangenen Jahren Stichworte wie „Mobilität”, „Heimat”, „Zeit” oder „Brauch – Ritual – Mythos” die Denkrichtung vor, entschied man sich für 2002/2003, der Frage „Was aber ist das Schöne?” nachzugehen.
Auf den ersten Blick mag diese Fragestellung eine nicht nur problematische, sondern wegen ihres subjektiven „Charakters” sogar eine hinfällige sein. Darüber hinaus wäre es ein Irrtum, würde man annehmen, dass die Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung auf das Finden einer Lösung ausgerichtet wäre. Nicht das Lösen der Frage, sondern die Präzisierung ist das Anliegen.
Von der Antike bis ins 18. Jahrhundert wird die Meinung vertreten, dass die Schönheit materialer Teil des als schön bezeichneten Gegenstandes wäre. Erst im Zuge der Entwicklung der von Alexander Baumgarten grundgelegten „Ästhetik als Wissenschaft” wird diese Ansicht endgültig verworfen. 1757 stellt der Empiriker David Hume in seinem Werk „Of the Standard of Taste” das Entscheidende und bis heute Gültige fest: „Beauty is no quality in things themselves: It exists merely in the mind which contemplates them.”[3045] Schönheit ist also keine Eigenschaft der Dinge, Schönheit ist nichts, was an den Dingen selbst festzumachen wäre. Humes Feststellung ist mühelos zu untermauern, indem man eine Liste von unterschiedlichen, aber augenscheinlich „schönen” Objekten, Gegenständen etc. (z.B. Rose, Sonnenuntergang, Gustav Klimts „Kuss”, Marylin Monroe, die amalfitanische Küste und der Ort Positano) anfertigt. Doch es wird nicht möglich sein, jenen Teil zu lokalisieren, der für das Schöne ausschlaggebend ist.
Man wird sich vielleicht noch an die Eröffnungsrede des österreichischen Bundespräsidenten zu den Salzburger Festspielen 1999 erinnern. Das Publikum hatte mit Zwischenapplaus reagiert, doch die Künstlerschaft und mit ihr der Intendant Gérard Mortier waren empört. Was war geschehen? Präsident Klestil hatte in seiner Rede Werktreue statt Stückezertrümmerung, humanistisches Bildungstheater und Harmonie statt Konfrontation gefordert, und er hatte für Stil und Geschmack sowie für das besonders Kluge und Schöne plädiert. In der Folge war in den Medien von „allgemein herrschender Borniertheit in kulturellen Fragen” und „Ahnungslosigkeit in künstlerischen Angelegenheiten”, sogar von „Klestils Wahnwitz” und einem Plädoyer für Verlogenheit in der Kunst zu lesen. Klestil erwarte sich, so Mortier, von der Kunst vor allem Entertainment, nicht Katharsis. Lediglich Marcel Prawy gratulierte in einem offenen Brief in der Kronenzeitung: „Ihnen, verehrter Herr Bundespräsident, gilt unser Dank.”
Wie dieser mittlerweile kulturhistorische Vorfall zeigt, ist es sehr verfänglich, von der zeitgenössischen Kunst Stil, Geschmack und Schönheit einzufordern; und die Äußerung des Präsidenten wird man wohl als den (unreflektierten) Wunsch nach leicht konsumierbaren Werken interpretieren müssen. Doch genau diesem Bedürfnis, der Sehnsucht nach Betulichkeit und leichter Unterhaltsamkeit kann und will der Künstler nicht entsprechen, gehört es doch zu seiner Aufgabe, „eine Art Frontstellung gegen die bürgerliche Bildungsreligion und ihr Zeremoniell des Genusses” (Gadamer) zu errichten. Und die Erklärung für diese doch peinlich anmutende Wortmeldung des Präsidenten mit den angedeuteten Folgen bringt eine mittlerweile bekannte Formulierung, die aus dem 19. Jahrhundert stammt: die Schönheit liegt im Geiste des Betrachters. Das heißt, die Aussage bzw. das Urteil, etwas sei schön oder eben hässlich, meint nur den eigenen emotionalen Zustand und ist keine allgemein gültige Aussage über den beurteilten Gegenstand, es ist „nur” ein Geschmacksurteil. Damit ist aber unser Geschmacksurteil eine Aussage über uns selbst, nicht jedoch über das beurteilte Objekt. Schönheit ist kein Begriff, der sich auf das Objekt bezieht, und das Geschmacksurteil ist kein logisch begründbares Urteil, es ist kein Erkenntnisurteil.
Trotzdem ist die „Schönheit” als Bedürfnis und somit als Begriff aus unserem Sprachgebrauch nicht wegzudenken. Darüber hinaus fordert das Jahresthema „Was aber ist das Schöne?” auch nicht Schönheit ein, sondern fragt nach ihr, fragt, was es mit der Schönheit auf sich hat, oder unter welchen Umständen man von Schönheit sprechen kann. Wie aktuell diese so komplexe (wie diffuse) Fragestellung ist, lässt sich durch die „kulturelle Praxis” belegen. So war zum Beispiel im Jahr 2000 in Washington und München die Großausstellung „Beauty Now” zu sehen; die Galerie Carinthia veranstaltete ein Symposion zur „Schönheitsfrage” und publizierte einen Tagungsband, eine der Ausstellungen des Kunstraums Innsbruck im Jahr 2002 nannte sich „The Beauty of Intimacy” die Fotografin Margherita Spiluttini betont, dass sie sich seit Jahren mit dem Schönen bzw. mit der Schönheit auseinandersetzt, Gerold Tusch sieht die Resultate seiner Arbeit als Reflexionen über Vermittlung und Transformation der Vorstellung vom Schönen, die Video-Künstlerin Pipilotti Rist interessiert sich für das Subversive an der Schönheit, Helmut Jasbar ging mit Albert Hosp in einem Ö1- Radiogespräch mit dem bezeichnenden Titel „Die schöne Stelle” der Frage in musikalischer Hinsicht nach, Wolfgang Rihm diskutierte in der FAZ „Die schönen Stellen der musikalischen Literatur”, Otto Penz schrieb das Buch „Die Metamorphosen der Schönheit” usw.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass laut Schulorganisationsgesetz die Schule die Aufgabe hat, „an der Entwicklung der Anlagen der Jugend (...) nach den Werten des Wahren, Guten und Schönen” (sic!) mitzuwirken, wird erst recht die Brisanz der Fragestellung deutlich. Wer entscheidet denn, was wahr, gut und schön ist?
Schönheit ist einem ständigen Wandel unterworfen, daran ändert auch der für eine gewisse Zeitspanne hergestellte Konsens über die Vorstellung von Schönheit nichts. Es bedarf keiner Beispiele dafür: jeder kennt die Macht der Mode und ihr Diktat, dem man sich schwerlich entziehen kann, wobei sich in unserer Zeit ein pluralistisches Bild von Schönheit abzeichnet: Schönheit ist eine soziale Konstruktion in ihrer Zeit. „Wenn der einen heute etwas missfällt, was dem anderen gestern gefallen hat, so ist dies eben nicht simpler Ausdruck privater Gusti, sondern weit eher ein Ergebnis komplexer gesellschaftlicher Artikulationsprozesse.”[3046]
Die Aussage „... ist schön” oder „... ist hässlich” ist ein Geschmacksurteil. Was es bedeutet, etwas als schön zu bezeichnen, beantwortete der Philosoph Immanuel Kant mit der berühmten Formel „schön ist was ohne alles Interesse gefällt” und der Kant- Kenner Jens Kulenkampff so: „Etwas schön zu nennen, das heißt, es aus der empirischen Mannigfaltigkeit herauszugreifen und zum Gegenstand einer nun erst anhebenden und mit Kant spekulativ zu nennenden Erkenntnis zu machen."[3047] Ausgeschlossen aus dieser Erkenntnis ist jedoch jene, die sich auf die Regeln des „reinen Verstandes” berufen möchte und entscheidend ist: Es gibt eine Beurteilungsinstanz unabhängig vom Verstand, nämlich die sinnliche Erkenntnis. Nicht nur der Logik, der Ratio, ist die Möglichkeit zuzugestehen, die Wirklichkeit der Welt zu erfassen.
Die Frage „Was aber ist das Schöne?” darf nicht als Aufforderung verstanden werden, sich auf die Suche nach allgemein gültigen schönen Dingen, schönen Momenten, schöner Musik etc. zu machen, sondern als Frage nach den Bedeutungen von „schön”, nach der Konstruktion von Schönheit. Sie möchte den Wandel der Vorstellung von Schönheit transparent machen und setzt voraus, dass es keine gewissermaßen objektive Sicht auf das „subjektfixierte” Phänomen Schönheit gibt. Im Grunde wird immer auch ein pädagogischer Anspruch mittransportiert: etwas als schön zu bezeichnen hat subjektiven Charakter und kann daher nicht als Kriterium für Bewertungen herangezogen werden. Die Schlussfolgerung: x ist schön, daher ist x gut, muss relativiert werden – das Attribut „schön” im Sinne eines Bewertungskriteriums ist hinfällig.
Für die Veranstaltungspraxis selbst lassen sich wenigstens vier Ebenen nennen, auf denen die Herangehensweise an die Frage basierte, was denn nun das Schöne sei. Erstens ging es darum, das Thema respektive die Problematik weiterzugeben, um Mitdenker zu gewinnen. Zweitens wurde auf sprachliche Gegebenheiten Rücksicht genommen: was bedeutet es zum Beispiel, einen Film mit „Beautiful People” oder „A Beautiful Mind” zu betiteln? Geht es in diesem Film um schöne Menschen oder schöne Gedanken? Drittens eröffnen sich andere „Betätigungsfelder”, denn die Frage des Schönen wird in erster Linie in der Mode, der Werbung und im Design gestellt und geklärt – wenn auch nur scheinbar und jeweils für eine (kurze) Zeitspanne. Viertens: das Schöne im Sinne des Erhabenen bedeutet die Suche nach starken sinnlichen Eindrücken. Naturgemäß ließen sich genügend Veranstaltungen der Vergangenheit der „Schönheit” zuordnen, aber nun wirkt auch die Reflexion über die Frage „Was aber ist das Schöne?” mit. Letztendlich: Es wird wohl viele Spielarten des Schönen geben, wie auch die Nähe des Schönen zum Kitsch nicht von der Hand zu weisen ist, aber das macht die Auseinandersetzung ja interessant.
So wenig klar es ist, vom Schönen zu sprechen, lohnt sich die Mühe, diesen ständig strapazierten Begriff, mit dem noch dazu ein Werturteil verknüpft ist, auf seine Tauglichkeit hin zu überprüfen. Ludwig Wittgenstein meinte: „Man muss manchmal einen Ausdruck aus der Sprache herausziehen, ihn zum Reinigen geben, – und kann ihn dann wieder in den Verkehr einführen.” Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich die Entscheidung, sich mit der Schönheit auseinander zu setzen, auch als Dienst an der Sprache, an unserem vorrangigen Kommunikationsmedium, interpretieren.
Durch das gesamte letzte Jahrhundert zieht sich das Misstrauen der Künstler dem Schönen bzw. die Skepsis dem so genannten schönen Schein gegenüber: die Zertrümmerung des gewohnten Formenkanons, Grenzüberschreitungen und Provokationen usw. waren die Folge. „Dieses Verlangen, das Schöne zu zerstören, war die Triebkraft der modernen Kunst”, so der amerikanische Maler Barnett Newman 1948. Die neuen Leitvokabeln in der Kunst heißen (zum Beispiel) Erweiterung der Wahrnehmung, Aufklärung, Problembewusstmachung, soziales Engagement, Verstörung und Irritation – und dafür bietet das Schöne bzw. das nicht Schöne genügend „Angriffsfläche”. Die insgesamt acht Positionen – eine davon war ein Mode/Designduo – zeichneten sich durch unterschiedliche Medien (klassische Malerei, Fotografie, Plastik, Video, Installation) und divergente konzeptuelle Ansätze aus. Darüber hinaus wurden die Beteiligten gebeten, sich mit einem Statement zu ihrer Arbeit und zur Schönheit gewissermaßen selbst zu positionieren. Die Beteiligten von SCHÖN waren Christina Breitfuß, Peter Haas, Reinhart Mlineritsch und Gerold Tusch sowie Otto Neumaier (Kunsttheoretiker), der den Eröffnungsvortrag „Schönheit, die ich meine” hielt. Bei SCHÖNER waren das Modelabel rosa mosa, Margherita Spiluttini, Walter Strobl und The Video Sisters dabei, den Vortrag mit dem Titel „Schönheit und Begehren” hielt der Soziologe Otto Penz. Eine Publikation wurde produziert, die eine Auswahl der ausgestellten Exponate zeigt, die Statements sowie diese theoretischen Auseinandersetzungen mit der komplexen Thematik des Schönen enthält. (Das Ausstellungsprojekt wurde im darauffolgenden Jahr mit NOCH SCHÖNER und AM SCHÖNSTEN... fortgesetzt. Auch diese zwei Austellungen sind durch eine Publikation dokumentiert.)
Ein anderer Ansatz waren moderierte Konzerte: nicht im Sinne des Erklärens dessen, was als schön zu empfinden sei, sondern in dem Sinn, „Hörhilfen” anzubieten. Speziell die zeitgenössische Musik bietet einerseits Hörerlebnisse spezieller Natur und bisweilen befremdenden Charakters, aber die Moderation könnte Zugänge schaffen, die dem Zuhörer das „Hinhören” erleichtern. So spielte der Pianist Matthias Soucek Salonmusik, nämlich Walzer und Polka, aber in Bearbeitung, sowie Kompositionen von Sergej Rachmaninow, dessen Musik nachgesagt wird, in einer gewissen Weise aufdringlich – schwülstig – zu sein. Soucek ist anderer Meinung: für ihn ist die Musik von Rachmaninow grandiose Musik. Das Duo :nota bene: (Eva Steinschaden, Violine und Alexander Vavtar, Klavier) nannte ihr moderiertes Konzert „Aspekte des Schönen in der Musik des Abendlandes”. An Hand von Werken von Mozart, Schubert, Ravel und dem St. Johanner Komponisten Christian David Kardeis wurde der Versuch einer musikalischen und gedanklichen Annäherung an das Schöne in der Musik – und der Kunst im Generellen – gewagt.
Die Berliner Stimmakrobatin Hilde Kappes betitelte ihren Auftritt, der besser mit Musikperformance zu bezeichnen ist, mit „Das Schöne im Absurden”. Kappes' Auffassung von Schönheit ist eine andere. Schönheit in der Musik ist für sie elementarer Ausdruck. Das Schöne ist immer nur dann schön, wenn es in der Ergänzung zum Gegenteil steht – was auch immer für den einen oder anderen das Gegenteil bedeutet. Mit ihrer Stimme, dem Klavier und akustischen „Ergänzungen” bricht sie bewusst das so genannte „Schöne”, um an Klänge zu gelangen, die einer tieferen Intensität und somit einer anderen Art von Schönheit Platz machen.
Petra Stump stellte in ihrem Solokonzert mit Bassklarinette ein Instrument mit einem erstaunlichen Tonumfang und einem immensen dynamischen Spektrum vor. Diese neuen, noch nie gehörten Klänge – sind sie schön? Schön ist das, was laut Immanuel Kant „ohne Interesse” und aufgrund des Geschmacks gefällt, doch der Geschmack ist ohne Zweifel auch eine Frage des Wissens.
„Beau Soir” war ein Konzert mit Virginia Dellenbaugh (Mezzosporan) und Stephen Delaney (Klavier). Französische Lieder des 20. Jahrhunderts wurden ausgewählt nach der Poesie der Texte. Beauty in love, nature and landscape – so beschrieb die Sängerin die Inhalte der Lieder, deren „Mélodie” in erster Linie von exotischer Schönheit zu sein hatten, um reines ästhetisches Vergnügen zu bieten – l'art pour l'art: Kunst um der Kunst willen.
„Nur der Schönheit weiht` ich mein Leben” ist eine berühmte Stelle aus einer Arie der Oper „Tosca” von Giacomo Puccini. Unter diesem Motto stand der Abschlussabend des internationalen Meisterkurses, der von Josef Loibl in Goldegg abgehalten wird. Die Liedauswahl für diesen Abend war, dem Motto entsprechend, Bekanntes und Wunderschönes aus der Welt der Oper und Operette. Rachel Lynn Bowman (Sopran) und Andreas Maria Germek (Gitarre) nannten ihr moderiertes Konzert „Schöne Melancholie”- spanische Lieder von der Renaissance bis zur Gegenwart. Das Konzept des Programms war es, dem Publikum die eigenartige, wohlige Stimmung von Melancholie, Traurigkeit und auch Ironie als einen weiteren Aspekt von Schönheit vorzustellen.
Der sechzehnköpfige Kammerchor Salzburg brachte opulente Musik unter dem Titel „Keine Liebe ohne Schönheit”. Weltliche Chormusik vom barocken Claudio Monteverdi bis in die Gegenwart.
Mag man die Betitelungen der einzelnen Konzerte auch als etwas zu aufgesetzt empfinden, transportiert eben dieser sprachliche Moment die Absicht des Kulturvereins: dem Zuhörer die Frage respektive das Jahresthema mit auf den Weg geben. Es lag jedoch nicht in der Intention des Veranstalters, die Musiker und Ensembles zu drängen, ihrem üblichen Programm lediglich einen passenden Titel zu geben, dies wäre einem Etikettenschwindel gleichzusetzen. Die Bereitschaft, die Frage „Was aber ist das Schöne?” als legitime Frage anzuerkennen und sich damit auseinanderzusetzen, sollte gegeben sein.
Ausstellung, Kino, Konzert, Vortrag – das sind die wesentlichen, alphabetisch geordneten Veranstaltungskategorien. Der erste Schritt des Kulturvereins war aber ein spezieller Schönheits-Wettbewerb, nämlich seine Mitglieder sowie die Kunst- und Kulturschaffenden, mit denen bislang kooperiert wurde, aufzufordern, Stellung zum Jahresthema zu beziehen und ihre Meinung – Was ist für Sie schön? – mitzuteilen. Diese Befragung brachte eine große Anzahl an Rückmeldungen: zum Beispiel reagierte Andrew Phelps mit einer Fotografie, Renald Deppe sandte eine Komposition, der Cartoonist Peng antwortete satirisch, Franzobel betitelte sein kurzes Statement mit „Die Schönheit ist eine Eintagsfliege, sie lebt nicht lange”, Johann Jascha zeichnete einen Gedankenknäuel und kam zum Ergebnis „Schiach ist schön”...
Im Ausstellungsbereich wurden in zwei Durchgängen jeweils vier Positionen aus dem Bereich der bildenden Kunst gezeigt; um die komplexe Thematik auch theoretisch zu thematisieren, wurde jeweils ein Wissenschafter eingeladen, im Vorfeld der Eröffnung einen Vortrag zu halten. Die Betitelung der zwei Ausstellungen mit SCHÖN und SCHÖNER sollte signalisieren, dass es sich um ein Ausstellungsprojekt in zwei Teilen handelte. Es ist Wesensbestandteil der zeitgenössischen Kunst, falsche Fährten zu legen – erwartete sich der Besucher aufgrund des Ausstellungstitels „schöne” Bilder oder reizvolle Arbeiten, war er möglicherweise enttäuscht. Denn von Schönheit im üblichen Sinn kann man bei den ausgestellten Werken vielleicht nur auf den ersten Blick sprechen können – oder erst auf den zweiten!
Aus der jahrelangen guten Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Valenta, den Betreibern des einzigen Wanderkinos im Land Salzburg, ergab sich vor fünf Jahren die Idee, den Innenhof von Schloss Goldegg im Sommer für Film-Veranstaltungen zu nutzen – wenn es das Wetter erlaubt. Fünf zumindest mit dem Prädikat „sehenswert” ausgezeichnete Filme wurden für 2002 ausgewählt: „Beautiful People” und „Beautiful Mind” wegen des Titels, da es auch zum Konzepts gehörte, den sprachlichen Verfasstheiten nachzugehen; „Evita”, der Film als Musical mit Madonna in der Hauptrolle, bot der Trachtenmusikkapelle Goldegg die Gelegenheit, im Vorprogramm ein Konzert mit berühmten Film-Musik-Hits wie „Don`t cry for me Argentina” oder „Spiel mir das Lied vom Tod” zu spielen; die Komödie „Lang lebe Ned Divine” war als qualitätvolle Unterhaltung gedacht, ebenso wie „L'Ultimo Bacio”, der im italienischen Originalton vorgeführt wurde. „L'Ultimo Bacio” wiederum war in Absprache mit dem Fremdenverkehrsbüro ausgewählt worden.
„Mein Gott, wie schön” nannte man kulturvereins-intern die eher lose, über das Jahr verteilte Ansammlung von Konzerten aus verschiedenen musikalischen Welten und Zeiten, in der die auftretenden Musiker mit einem pointierten Programm die Fragestellung „Was aber ist das Schöne?” aufnahmen und aus ihrer Sicht konkretisieren sollten, indem zum Beispiel der Geschmackswandel thematisiert wurde, dem Klischee von schöner Musik nachgespürt wurde oder in Bearbeitungen gezeigt wurde, dass es sehr anregend und spannend sein kann, altbewährtes „Schönes” im Gegensatz zum Neuen zu erleben.
Die den Ausstellungen SCHÖN und SCHÖNER vorangestellten zwei Vorträge von Neumaier und Penz brachten einerseits eine philosophische, andererseits eine kultursoziologische Betrachtungsweise.
Es wäre wohl zuviel des Guten, zu meinen, die gesamte Veranstaltungstätigkeit des Kulturvereins Schloss Goldegg müsste dem Jahresthema zuzuordnen sein. Neben dem „roten Faden” Jahresthema baut die Kulturarbeit auf Arbeitsfeldern und Kooperationen mit anderen Institutionen, die seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, bestehen. Die vier herausragendsten Beispiele dafür sind die „Goldegger Dialoge”, die Seminarreihe „Begegnungen – Gesundheit und Lebens-Lust”, die „Blues- und Folktage” sowie die Werkstattwoche „Spiel Raum Musik”.
Die „Goldegger Dialoge” fanden 2003 zum 22. Mal statt. Sie sind das Herzstück im Veranstaltungskalender und repräsentieren mit ihrem Motto „Gesundheit ist lernbar” einen weiteren Aspekt des weiten Kulturbegriffs, dem man sich in Goldegg verpflichtet fühlt. Jedes Jahr einer anderen Thematik gewidmet, lautete der Titel für 2003 „Aus der Egoismusfalle – Selbstfindung zwischen Einsamkeit und Geborgenheit”. Wie immer ging es in bewährter und lang erprobter Weise darum, verschiedene Zugänge zur Thematik anzubieten. Der grundsätzlich gegebene Publikumszuspruch der mehrtägigen „Dialoge” ist erstens auf die attraktive und prominente Teilnehmerliste (2003 waren es Franz Alt, Reimer Gronemeyer, Matthias Horx, Herrad Schenk, Regine Schneider, Pierre Stutz, Bärbel Wardetzki, Jürg Willi) zurückzuführen, zweitens auf die Kooperation mit der Ärztekammer Salzburg, dem ORF Salzburg sowie den Salzburger Nachrichten. In einem Tagungsband sind die Ergebnisse nachzulesen.
Seit Jahren hat sich die Seminarreihe „Begegnungen auf Schloss Goldegg” etabliert, die stark emanzipatorischen Charakter aufweist. Für viele ratsuchende Menschen in der Region ist diese Reihe eine wichtige Anlaufstelle geworden; analog zu den „Dialogen” ziehen die „Begegnungen – Seminare für Gesundheit und Lebens-Lust” einen beträchtlichen Anteil ihrer Anziehungskraft aus der Referentenliste.
Die psychosoziale Versorgung ländlicher Gebiete und das Lebensumfeld von Menschen mit Behinderungen ist seit vielen Jahren ein wichtiges Teilgebiet der Kultur- Arbeit. 1996 von der Lebenshilfe Schwarzach initiiert, wurde das von Anfang an erfolgreiche Projekt „Spiel Raum Musik” im Jahr 2002 zum 6. Mal durchgeführt. Es handelt sich um ein Projekt, das in den Sparten Musik, Tanz und bildnerisches Gestalten die Begegnung von Profis mit Menschen mit Behinderung zum Inhalt hat. Die freie Improvisation ist das zentrale Anliegen dieser Werkstattwoche. Unter dem Motto „Im Schloss und ohne Riegel” stand am Ende der Woche eine Improvisationsperformance auf dem Programm, das als Fenster zu dieser Woche zu verstehen war.
Schon zum 14. Mal veranstaltet die Lebenshilfe Schwarzach in Kooperation mit dem Kulturverein Schloss Goldegg 2002 die „Goldegger Blues- und Folk-Tage”. Zwei Tage lang steht der Innenhof des Schlosses der Benefizveranstaltung zur Verfügung. Nicht einmal schlechtes Wetter konnte die Begeisterung der Musikgruppen und Besucher trüben.
Im Jahre 2002 konnte der Kulturverein Schloss Goldegg auf zwanzig Jahre Kulturarbeit zurückblicken. Was naturgemäß bescheiden begann, wuchs sich über die Jahre zum regionalen Kulturzentrum Schloss Goldegg aus. Der Anspruch, Kulturzentrum zu sein, verlangt freilich Professionalität. Essentieller Teil einer professionellen Veranstaltungsprogrammierung ist die Selektion, nämlich aus den unzähligen Auftritts- und Ausstellungsanfragen die „richtige” Auswahl zu treffen; im besten Fall trifft man die Entscheidung nicht über die eingereichten Unterlagen, sondern auf Grund der persönlichen Kenntnis des Kulturschaffenden bzw. dessen Arbeit. Je besser sich beide Seiten – Kulturarbeiter und Kulturschaffender – kennen, desto größer ist die Chance auf eine spannende Zusammenarbeit, in der Platz für Neues, Überraschendes und Innovatives ist. Denn was ist es, das uns affiziert: wohl doch das Neue, das Andere, das Unbekannte, das Verblüffende. Doch dieser Moment der Selektion beinhaltet entsprechendes Konfliktpotential, da jede Auswahl und die damit verbundene Zusage andererseits – nolens volens – Absagen nach sich zieht. Es gehört zu den schmerzlichen Erfahrungen der Kulturarbeit, dass Kulturschaffende Absagen persönlich nehmen, erst recht, wenn eine freundschaftliche Beziehung besteht. Allzu oft ist die Folge einer Nicht-Zusage die Kündigung der Freundschaft. Es scheint, Programmgestalter müssen damit leben, dass ihr Bemühen um eine profilierte und begründete Programmauswahl nicht nur auf Wertschätzung stößt, sondern auch „beleidigte Leberwürste” produziert.
Die Programmgestaltung ist jedoch nur einer von mehreren Bereichen, die über Erfolg oder Misserfolg der Kulturarbeit entscheiden. Inwiefern die geldintensiven, budgetaufzehrenden Bereiche Erscheinungsbild (Briefpapier, Logo, Programmheft, Website ...) und Werbung (Schalten von Anzeigen, Drucken von Plakaten, Foldern, Einladungskarten, deren Versand ...) die Kulturarbeit mit bestimmen, soll an dieser Stelle nur angedeutet werden. Liegen die genannten Bereiche Programmgestaltung, Erscheinungsbild und (Eigen)Werbung weitgehend im Kompetenz- bzw. im Einflussbereich der Kulturvereinsarbeit, so lässt sich das für die so genannte Pressearbeit nicht sagen. Bei der Pressearbeit, mag sie auch noch so akkurat sein, ist man immer Bittsteller und auf das Wohlwollen der Presseleute angewiesen. Aufbau und Pflege der Pressekontakte sind unumgänglich, wobei der Standort des Kulturvereins Schloss Goldegg unbestritten ein Nachteil ist. Die Entfernung von rund 65 km zur Stadt Salzburg, dem Sitz der überregionalen Printmedien sowie des ORF, zeigt sich oft als unüberwindbar – und der Pass Lueg als Rubikon. Ärgerlich ist dieser Umstand deshalb, weil das Echo in der Presse ein Bewertungskriterium für die Kulturarbeit ist, darüber hinaus gewinnt man als Veranstalter wie als Kunst- und Kulturschaffender ein entsprechendes Maß an Motivation aus dieser öffentlichen Präsenz, die sich nur zu einem geringen Teil durch bezahlte Anzeigen („Druckkostenbeiträge”) ausgleichen lässt. Spätestens wenn es darum geht, den Subventionsgebern die Jahresabrechung zu unterbreiten, ist der Pressespiegel, die Sammlung aller Presseberichte, das entscheidende Medium zur Rechtfertigung der getätigten Ausgaben.
„Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?” Ungeachtet der Tatsache, dass die Antwort auf diese Frage nie endgültig sein kann, muss sie immer wieder neu gestellt werden. Widersprechende Antworten sind in einer gewissen Weise systemimmanent, da sich Kulturarbeit in erster Linie mit sinnlichen Erfahrungshorizonten auseinandersetzt, doch sinnliche Erkenntnisse sind nicht richtig oder falsch – man denke nur an die Frage „Was aber ist das Schöne?” – sondern höchstens anders. Die beleidigten Leberwürste sollten sich das zu Herzen nehmen ...
Verwendete Literatur:
Websites der Salzburger Kulturinitiativen am Land:
Jazzszene Lungau [Anm.: Bestand bis 2005.]
Jazzfestival Saalfelden
Bad Hofgastein, Jazz im Sägewerk
Kulturverein Schloss Goldegg
Kulturkreis DAS ZENTRUM Radstadt
LeogangerKinderKultur
Kulturforum Hallein
Kunstverein Galerie Zell am See
Kulturverein Pongowe/Bischofshofen
Kulturverein Werfen-Tenneck
artacts St. Johann
[Salzburger Landeskulturbeirat 2000] Salzburger Landeskulturbeirat (Hg.): L@nd. 29 Positionen zu Kunst und Kultur im Land Salzburg. Salzburg 2000.
[Salzburger Kulturlexikon 2001] Haslinger, Adolf; Mittermayr, Peter (Hg.): Salzburger Kulturlexikon. 2. Aufl. Salzburg [u. a.] 2001.
[3039] [Salzburger Nachrichten]. Beilage Salzburg life. 12. Juli 2002, S. 4.
[3040] Zur Begriffsklärung von Kultur siehe z.B. [Schiffauer 2002].
[3041] In: [Salzburger Landeskulturbeirat 2000], S. 6.
[3042] In: [Salzburger Landeskulturbeirat 2000], S. 5.
[3043] Fälschlicherweise gibt das [Salzburger Kulturlexikon 2001], S. 261 als Gründungsjahr 1970 an. An und für sich ist das Kulturlexikon ein brauchbares Nachschlagewerk, doch bedauerlicherweise sind eklatante Lücken zu beklagen. (Siehe dazu die Rezension des Autors [KaiserH 2001].)
[3044] Thuswaldner in den „Salzburger Nachrichten“ 1996. Zit. nach: [Steinwendtner/Holl 2000], S. 15.
[3045] „Schönheit ist keine Eigenschaft, die in den Dingen selbst liegt: Sie liegt einzig im Geist dessen, der sie betrachtet.“ Zitiert nach: [RitterJ/Eisler 1971]. Bd. 8, Sp. 1371. Siehe auch [Danto 1999].
[3047] [Kulenkampff 1994], S. 170.