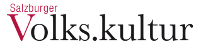

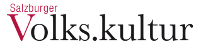

Volksmusik beschränkt sich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive nicht allein auf eine bestimmte musikalische Tradition, sondern sie verknüpft sich mit den Biographien von Menschen sowie Orientierungen, Werten und Entwicklungen einer Gesellschaft. Wir beschäftigen uns im folgenden Beitrag nicht mit Volksmusik als einer musikwissenschaftlichen Gattung, sondern spannen Volksmusik in ein ethnographisches Projekt ein, das wir 2001 und 2002 unter dem Titel „TraditionenBrüche” durchgeführt haben.[2342] Das Gesamtprojekt hatte mehrere Zielsetzungen, die wir hier präsentieren.
Mit „TraditionenBrüche” verband sich das Anliegen, über Volksmusik und Volkskultur als Formen einer popular culture Bildungsprozesse auf zweifache Weise zu initiieren: erstens durch die reflexive Bearbeitung der eigenen Biographie, zweitens im Bereich der Erwachsenenbildung in regionalen, oft traditionsgebundenen Vereinen und drittens durch die Analyse alltagskultureller Praktiken mit dem Konzept der Cultural Studies. Ein Wort zur Schreibweise des Titels: TraditionenBrüche zeigt nur noch in Form des großen B die Zusammensetzung zweier Wörter an, die ansonsten miteinander verschmelzen und zu einem Wort werden. Auf diese Weise verstehen wir auch das Zusammenspiel von Traditionen und Brüchen. Die Differenzen sind klein, Traditionen lassen sich ohne Brüche nicht verstehen, und Brüche sieht man nur vor dem Hintergrund von Traditionen, die die Kontinuität betonen. Uns ist also daran gelegen, einerseits in Traditionen Brüche sichtbar zu machen und andererseits zu sehen, dass Brüche immer schon in Traditionen eingelassen sind.
„Volksmusik riecht nach dem verbrannten Kaffee meiner Großmutter. […] In der Volksmusik verdichten sich die Alltagsrituale: die Sonntagmorgenrituale, die Autowasch- und Rasenmährituale, die Essens- und Schlafgehrituale. Sie ist ein Speicher für Erinnerungen von Bildern, Gerüchen, Stimmungen, Ängsten und Glücksmomenten, die auf diese Weise als Teil unserer Biographie weiterleben, uns verändern und zu dem machen, was wir sind. Aber davon wissen wir nichts. Es bleibt nur eine Spur: Volksmusik gefällt mir oder ich finde sie unausstehlich. Meistens ist die Spur ambivalent: Nur nach Zögern mag ich zugeben, dass mich die eine oder andere Volksmusik widerwillig anzieht.”[2343] Volksmusik ist, wie dieses Zitat verdeutlichen soll, nicht nur eine bestimmte Musikrichtung. An sie heften sich biographische Ereignisse, die sich mit ihr unauflöslich vermischen. Aber Volksmusik ist auch Trägerin sozialer, kultureller und politischer Bedeutungen, sie ist gewissermaßen die materielle Seite von kulturellen Bedeutungen. Da sich diese Bedeutungen im Laufe kultureller Entwicklungen in die Volksmusik einbrennen, scheint es, als seien bestimmte Bedeutungen mit der Volksmusik natürlich und unauflöslich verwachsen und nicht das Ergebnis gesellschaftlicher Prozesse. Darin besteht auch die Ideologie von Volksmusik und anderen Formen der Populärkultur. Sie negieren den politischen Charakter der Verknüpfung von Bedeutung und Volksmusik.
Erst indem der Blick gewechselt und deutlich gemacht wird, dass Volksmusik auch Anderes als nur Musik artikuliert, wird sie als ethnograpisches Projekt bedeutsam. Unser Zugang zum Thema Volksmusik wird vornehmlich durch zwei theoretische Strömungen bestimmt, die eng miteinander verknüpft sind: den Cultural Studies[2344] auf der einen Seite und der ethnographischen Forschung[2345] Cultural Studies sind für uns deshalb besonders wichtig, weil es uns darauf ankommt, alltägliche Lebensvollzüge wie Rituale, Denk- und Sichtweisen, aber auch Empfindungen, Gerüche usw., die sich mit subjektiven Vorstellungen von Volksmusik verbinden, in Familien- und Dorfgeschichten und alltägliche Beziehungen und Lebensweisen eingelagert sind, zu erforschen und zu bearbeiten. Wir übernehmen also von den Cultural Studies einen Begriff von Kultur, der nicht mehr mit „Hochkultur” gleichgesetzt werden kann, sondern vielfältige bestehende und mögliche Lebensweisen, ihre Organisations- und Kommunikationsformen umfasst.[2346] Mit der Ethnographie teilen die Cultural Studies, dass sie den Menschen als ein Wesen auffassen, „das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe”, so Clifford Geertz.[2347] Bedeutungen werden in kulturellen Praktiken hergestellt, verändert, gegenüber anderen verteidigt und mit ihnen verhandelt. Volksmusik ist als eine Form von Popularkultur Teil dieses Bedeutungsgewebes, das in kulturellen Praktiken mit anderen Elementen des Gewebes artikuliert wird.
Die Erforschung der Popularkultur hat in den Cultural Studies und in der ethnographischen Forschung eine lange Tradition, weil es beiden theoretischen Modellen darum geht, die „wirkliche Welt” bzw. das gewöhnliche, alltägliche Leben von Menschen einzufangen.[2348] Lawrence Grossberg spricht von kulturellen Formationen und versteht darunter ein „Netz, das kulturelle Praktiken, ihre Auswirkungen und soziale Gruppen miteinander verbindet”.[2349] Volksmusik lässt sich als überdeterminiertes Bedeutungselement einer solchen kulturellen Formation verstehen. Als im besonderen Maße „loaded term” eignet sich Volksmusik als strategischer Begriff bei der Bearbeitung der eigenen Biographie oder bei der Erforschung von Bildungsprozessen in ländlichen Regionen. Volksmusik macht Geschlechter- und Generationendifferenzen sichtbar, Volksmusik wird zum Anlass für familiäre Auseinandersetzungen und für das Erinnern lokaler Rituale. Abseits von konkreten historischen Ereignissen bildet Volksmusik eine Art historisches Gedächtnis. Zumindest hat sie häufig die Funktion einer Statthalterin für unterschiedliche Auffassungen und Beziehungen zur eigenen Geschichte. Volksmusik benennt unterschiedliche Problematisierungsebenen und verbindet sie miteinander. Deswegen sprechen wir davon, dass Volksmusik Teil eines machtvollen diskursiven Feldes ist, das nicht allein mit musikalischer Orientierung zu tun hat, sondern unterschiedliche Lebensbereiche und Praktiken betrifft. Die Art und Weise, wie junge Erwachsene Volksmusik beurteilen, zeigt, dass sich populare Diskurse nicht fein säuberlich in soziale, kulturelle und politische Sphären trennen lassen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass kulturelle Praxen und kulturelle Formationen immer auch politisch und sozial sind und dass sich individuelle Lebensgeschichten mit politischen Kulturen treffen und diese sich wechselseitig prägen.[2350]
Die Tatsache, dass sich ein ethnographischer Begriff von Volksmusik nicht auf eine einzige Bedeutung zurechtstutzen lässt, sondern immer neue Verknüpfungen und damit Bedeutungen hervorbringt, also ständig neue Lesarten erzeugt, bildet eine notwendige Voraussetzung für seinen strategischen Einsatz in Bildungsprozessen. Bildungsprozesse initiieren heißt, alltägliche Praktiken zu reflektieren und zu verändern, neue Sicht- und Denkweisen zu entwickeln und damit eingeschliffene Handlungsweisen kritisch zu beleuchten. Entscheidend ist, dass diese Form der Bildung auf alle Sinne zielt. Das bedeutet erstens, dass mit Seh-, Hör-, Geschmacks- und Tastgewohnheiten gespielt wird und dass zweitens die Bedeutung des Sozialen als Ritual erfahrbar gemacht wird. Zum rituellen Charakter von Bildungsprozessen zählen die Elemente des Ludischen, der Körperlichkeit, der Macht, der Regelhaftigkeit und schließlich des Heiligen, das eine Dimension aller rituellen Prozesse ist.[2351]
Es geht, in der Sprache der Cultural Studies, um die vielfältigen Artikulationen,[2352] die Volksmusik produziert und ständig reproduziert. TraditionenBrüche bezeichnet dabei die Verschlingung von Kontinuitäten und Brüchen, von Spannungen und unbefragten Selbstverständlichkeiten. Aus der Sicht der Kultur- und Sozialwissenschaften fragen wir nach der gesellschaftlichen Wirkungsweise dessen, was Menschen unter Volksmusik verstehen. Unser Augenmerk legen wir auf die Frage, warum Volksmusik und einzelne darum herum gruppierte volkskulturelle Traditionen in der Lage sind, die Menschen in heftige BefürworterInnen und GegnerInnen zu spalten, sie emotionell für und gegen Volksmusik aufzubringen. Dabei ist es von Interesse, dass unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Zugänge zur Volksmusik entwickeln, Unterschiedliches zur Volksmusik hinzurechnen und unterschiedliche Volkskulturen mit gänzlich unterschiedlichen Zuschreibungen versehen. Immer beschreibt Volksmusik ein machtvolles Feld mit Grenzziehungen, mit Inklusionen und Exklusionen. Solcherart wird nicht nur Fremdes, sondern auch das Eigene konstruiert.
Während in der ethnographischen Forschung der Konstruktion des „Anderen” großes Augenmerk geschenkt wurde, interessieren wir uns dafür, wie über Volksmusik das „Eigene” hergestellt und repräsentiert wird. Marlene Streeruwitz hat auf diese Weise „Heimat” rekonstruiert: „Heimat beschreibt von einem Ort und seiner Kultur, was von diesem Ort und seiner Kultur beschrieben werden soll. Oder darf. Heimat ist ein Glaubensbegriff. Eine demagogische Konstruktion. Und Liebe zur Heimat kann dann nur Selbstliebe zu dem bedeuten, was man selber sein und sehen möchte. Ein wahnhafter Selbstbetrug. Bis es dann das Leben kostet. […] Heimat. Das ist eine schwer belastete Sinneinheit. In der Aufladung an Bedeutung, die über ‚irgendwo zu Hause sein' hinausgeht. In dieser Gefühlsaufladung liegen alle irrationalen Auslegungen und Reaktionen verborgen. Immer noch. […] Heimat als Zustand gibt es, weil es das Wort gibt. Alle anderen Sprachen begnügen sich mit ‚irgendwo zu hause sein', ‚von irgendwo stammen oder herkommen'. Umso schrecklicher oder, aus einer schrecklichen Ökonomie der Bedeutungen zwingend, war es, Personen dieses Zustands zu berauben. Sie ihrer Heimat zu verweisen. Heimat als Zulassungskriterium einzusetzen und darin auch als Zwang. Ich möchte keine solche Heimat. Und ich möchte keine Heimatgefühle, die mich dann an eine Welt binden, weil das Brot da so schmeckt, wie es mir eingetrichtert wurde.”[2353]
In Biographien ist die Konstruktion des Eigenen, die Herstellung dessen, was wir Identität nennen, mit dem Fremden untrennbar verbunden. Diese Herstellung von Identität funktioniert oft als mühsame Arbeit, in deren Verlauf manches „vergessen” werden muss. Anderes wird wiederum umgedeutet, neu gedeutet, relativiert, um es integrieren zu können. Kein Zweifel besteht darin, dass das Ausgeschlossene als Abwesendes stets präsent ist.
Ein Anknüpfungspunkt für unser Projekt zur Volksmusik ist die bekannte Annahme, dass ErzieherInnen immer erzogene ErzieherInnen sind. Deswegen besteht ein wichtiger Aspekt in der pädagogischen Ausbildung darin, eigene Biographien zu bearbeiten. Professionelles pädagogisches Handeln kann nur dann gelingen, wenn die eigene Erziehungs- und Sozialisationsgeschichte bearbeitet worden ist, damit eigene schmerzhafte Erfahrungen in den Jahren des Aufwachsens später nicht auf die eigene Klientel projiziert werden. Dazu gehören Familien- und Schulerfahrungen, aber auch viele Rituale des Aufwachsens. Der Kulturbegriff der Cultural Studies legt nahe, dass jede kulturelle Praktik für die eigene Biographie bedeutsam ist. Aber erst die Bearbeitung der eigenen Biographie lässt dies sichtbar werden. Wir gingen nun davon aus, dass Volksmusik eine Art Spur zu Vergangenheiten bildet, die biographisch relevant sind, sich bearbeiten lassen und dabei eine Menge von pädagogisch relevanten Problematisierungen hervorbringen. Unsere These ist, dass Volksmusik in den Biographien von jungen Erwachsenen aus vorwiegend ländlichen Räumen Oberösterreichs und Salzburgs als Knoten begriffen werden kann, der auf ein bedeutungsvolles Netz biographischer Bezüge verweist.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Biographien nicht einfach auf individuelle Lebensläufe reduziert werden dürfen. So macht etwa Theodor Schulze auf die doppelte Bedeutung des Begriffs „Biographie” aufmerksam. Biographie bezeichnet nicht nur das menschliche Leben, sondern der Begriff setzt sich aus bios und graphein, Leben und Schreiben,[2354] Biographie bezeichnet das Leben, aber eines, über das man Auskunft geben kann, weil es bereits nach einer bestimmten Logik, nämlich der des Lebenslaufs, erzählt werden kann. Wenn man von seiner Biographie spricht, stellt man bereits eine Distanz zu seinem Leben her, das nun in ein symbolisches Universum mit unterschiedlichen Deutungsmustern eingespannt ist. So individuell das Leben des einzelnen Menschen auch sein mag, die Biographie von diesem Leben ist nie nur individuell, sondern immer bereits sozial zugeschneidert. Die Biographie folgt Regeln der Darstellung, die selbst auf das Leben zurückwirken. Wenn Volksmusik strategisch zum Startpunkt für die Bearbeitung von Biographie wird, dann gehen wir bereits davon aus, dass es allen Unterschieden zum Trotz so etwas wie gemeinsame Bedeutungshorizonte gibt, innerhalb derer Biographien bearbeitet, interpretiert und reinterpretiert werden, die es erlauben gemeinsame Konflikte und Probleme darzustellen und zu verhandeln, so dass sie verstanden und kommunizierbar werden.
Volksmusik führt uns dazu, Familien- und Dorfgeschichten zu erkunden, das Verhältnis zu Heimat und Tradition in den Blick zu nehmen und zu untersuchen, wie die Verbundenheit zur Heimat und die Ablösung von Traditionen sowohl Identitäten als auch Brüche produzieren. Dabei decken Biographien die Vergangenheit nicht auf. Wenn von Biographien die Rede ist, handelt es sich vielmehr um einen aktiven Prozess der (Re)Konstruktion des Vergangenen in der Gegenwart. Geschichten werden nicht einfach so erinnert, wie sie gewesen sind, sondern sie werden erinnernd noch einmal geschrieben und neu geschrieben.[2355] Diese vielfachen Bezüge zwischen vergangenen Ereignissen, Erinnerungen, gegenwärtigen Lebensweisen und Vorstellungen von der Zukunft, die in unterschiedlicher Gestalt gegenwärtig sind, bilden zusammen ein narratives Netz, das die Biographie eines Menschen ausmacht. Sie zu bearbeiten, heißt, sich den vielfachen imaginären Dimensionen mit all den Verkennungen und Illusionen zu stellen.
Bei solchen Prozessen weist Musik einige Besonderheiten auf: Mehr als andere Themen aktualisiert und integriert sie alte Erfahrungen: „Das eine ist die Ebene der Emotionalität. Musik reproduziert diese Emotionalität sehr genau, und dies entspricht der subjektiven Empfindung, dass die Emotionen gewissermaßen zeitlos sind, nicht altern.”[2356] Dazu kommt ihre „Doppelhaftigkeit”: „Musik als Gegenstand der Erinnerung ist materieller als es Gedanken, Einstellungen und Werte sind und ist wegen seiner Dinghaftigkeit leichter und ‚objektiver' über die Zeiten hinweg transportierbar. Gleichzeitig ist Musik weniger materiell als andere erinnerungsträchtige Gegenstände wie Möbel, Kleidungsstücke oder Fotos und aus diesem Grunde ebenfalls leichter über die Zeiten hinwegzutransportieren: „‚Meine Gitarre wurde mir gestohlen, aber meine Lieder kann mir keiner wegnehmen'.”[2357]
Lebensgeschichtlich orientieren sich biographische Erinnerungen vorzugsweise an der Musik der Kindheits- und Jugendphase, wodurch die Unterschiede im Generationenvergleich besonders offensichtlich werden. Sie sind untrennbar mit milieu- und geschlechtsbezogenen Erfahrungen verwoben. „Musik zeigt sich zugleich als Ausdruck und Gestaltung sozialer Erfahrungsräume. Die subjektiven Bedeutungen des Umgangs mit Musik schlagen sich in der Beschreibung dieser sozialen Situationen nieder: Musik in der Familie, in den Schulstunden, beim Wandern, in Jugendgruppen, im Krieg, [...] hierbei werden in besonderem Maße Geschlechts- und Milieuzugehörigkeit deutlich.”[2358]
Der geschlechtsspezifische Zugang zum Musikleben steht in den biographischen Erzählungen von AutorInnen in enger Verbindung mit den Erinnerungen an typische Arbeitsverpflichtungen und Arbeitsrhythmen in den Lebenswelten ihrer Kinder- und Jugendzeit und den zugehörigen Geboten und Verboten: „Nun will ich aber erzählen, wie ich in meiner Jugend Musik erfahren habe. Wir hatten zu Hause eine Zither, ein paar Saiten waren gerissen, und wir durften darauf herumklimpern. Ich war vom Klang dieses Instruments so fasziniert, dass ich den fast krankhaften Wunsch hatte, das Instrument spielen zu lernen. Doch getraute ich mich nie, diesen Wunsch laut werden zu lassen, denn ich wußte genau, für diesen ‚Blödsinn' wäre kein Geld vorhanden gewesen, außerdem wäre ich für meine außerschulischen Pflichten – ich musste immer meine jüngeren Geschwister hüten – nicht zur Verfügung gestanden, ich hätte mich höchstens lächerlich gemacht, einen so ausgefallenen Wunsch zu haben.”[2359]
Speziell für ländliche Dienstboten waren in der Erinnerung heutiger älterer Menschen der Erwerb von Instrumenten und eine entsprechende Ausbildung nahezu unmöglich. Daher handeln die Erzählungen jener, die es doch geschafft haben, in den 20er oder 30er Jahren eine Zither, eine Harmonika oder eine Gitarre zu erwerben und zu spielen, von den Schwierigkeiten, sich einer gesellschaftlichen Norm zu widersetzen und sich den milieubezogenen Arbeitsrhythmen zu entziehen. „In den zwanziger und dreißiger Jahren gab es auf den Bauernhöfen keine technischen Behelfe, alles musste händisch erledigt werden, und das ausschließlich von den weiblichen Dienstboten. Um vier Uhr morgens, ob Sonn- oder Wochentag, begann für die Mägde die Arbeit in Haus und Stall und dasselbe wieder abends um vier Uhr, während die Knechte um vier Uhr ihren Feierabend hatten und außerdem den ganzen Sonntag frei. Für die Mägde gab es kein Pardon. [...] Es war für ein Bauernmädchen fast unmöglich, ein Instrument zu lernen, was ja nur am Samstagabend möglich gewesen wäre, aber gerade an diesen Abenden war die Arbeitsbelastung der Mägde eine doppelte, weil da außer der üblichen Arbeit noch alles saubergemacht und gereinigt werden musste. Dazu kam noch der stundenweite Weg ins Dorf.”[2360]
Bezogen auf die gesellschaftliche Wirkungsweise sind solche Erinnerungen jedenfalls geeignet, die Konstruktion einer Opposition zwischen partizipativer Volksmusik und hierarchisch organisierter volkstümlicher Schlagermusik, wie sie uns auch im Rahmen der Bad Ischler Tage zur Volksmusik begegnet ist, ganz anschaulich zu relativieren. Als zentrale historische Veränderung taucht in der biographischen Erinnerung das „Radio” auf. Die Möglichkeit technischer Reproduzierbarkeit trennt auch die ProduzentInnen und RezipientInnen von Musik nach Generationen bzw. Kohorten. Dort liegt auch ein Schlüssel zum Verständnis der Ablehnung volkstümlicher Musik. Gerne grenzen sich ältere AutorInnen lebensgeschichtlicher Erinnerungen gegenüber der Musik „der Jungen” ab. Kaum etwas prägt kulturell so stark wie Musik. Musiktherapeutische Erfahrungen der Gerontologie belegen, dass sich alte Menschen mit schweren Orientierungsstörungen möglicherweise nicht mehr an den eigenen Namen, dafür aber an die Musik ihrer Kindheit erinnern können: „Musikerfahrungen sind anscheinend weitgehend resistent gegen das Vergessen.”[2361]
Aufgrund solcher Prägungen des Geschmacks spitzen sich auf diesem Feld auch die Bilder von Generationskonflikten zu: „Das soll Musik sein? – fragen wir. Preisgegeben dem Hohngelächter der Jungen, wenn wir von Capri schwärmen, wo die ‚rote Sonne im Meer versinkt'. Was sie gerade noch gelten lassen, ist Elvis. Aber vermutlich auch nur deshalb, weil er der erste war, der auf der Bühne heftig mit den Hüften wackelte [...] Sein in der Mittellage angenehmes Timbre nimmt eh keiner wahr”.[2362]
Zugleich fällt auf, dass Erinnerungen älterer Menschen an jugendlichen Musikpraxen vorwiegend „auf Integration in die Welt der Erwachsenen angelegt” sind, jedenfalls nicht als Konkurrenz zu herrschenden Normen, allenfalls als freundlich gemeinter Scherz.[2363] Insbesondere für Kinder und Jugendliche in ländlichen Regionen waren Möglichkeiten, einen oppositionellen Stil zur Erwachsenenwelt zu wählen, so gut wie nicht vorhanden. Ältere Menschen aus dem bürgerlichen Milieu können dagegen – auch weil sie viel eher Zugang zu Radio und Plattenspieler hatten – von Erfahrungen mit dem besonders im Nationalsozialismus als „Negermusik” verpönten Swing erzählen. Eher verschämt flechten sich Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus in die Erzählungen über Kindheit und Jugend ein. Das Problem: Speziell Jugendliche aus ländlichem Milieu erfuhren durch den Anspruch des NS-Regimes auf ihre Mitgliedschaft in HJ und BDM eine Gegenwelt zu den Zwängen des eigenen Milieus. Das drückt sich auch in den Musikerfahrungen aus: „Dann kam in der siebten Klasse der BDM, war auch schön, denn da ging's mit dem Singen erst gut. Dann kam der Arbeitsdienst, da wurde erst recht gesungen. War mal sehr froh, in der Fremde zu sein, da war ich mit fünfzig Mädeln. Wir konnten sonntags bis sieben Uhr schlafen, das war für mich was Wunderbares, nicht im Stall. Meine Freundin und ich mussten eine Stunde zum Bauern gehen, da hatten wir natürlich viel Zeit zum Singen, denn das Singen hat uns Maiden wieder aufgemuntert.”[2364]
Im Projekt TraditionenBrüche ging es nicht zuletzt um Ambivalenzen. Viele Jugendliche kommen aus ländlichen Regionen mit entsprechender musikalischer Sozialisation und spalten aus der städtisch-universitären Perspektive des Studiums in Salzburg die damit verbundenen kulturellen Erfahrungen ab: „Volksmusik – igitt!” Unter der Anleitung von Hubert von Goisern wurde daher gesungen, gejodelt, marschiert und geklatscht: „Hinter meiner Stadeltür steht a oida Musketier”, zog sich durch alle Treffen. Eingeladen, sich von alten Stimmungen und Erinnerungen an Blasmusikkappelle, Kinderlieder und Heimatdialekt einfangen zu lassen, kramen auch die Studierenden in Erinnerungen und reflektieren die eigenen Abneigungen und Vorlieben: „Ich und Volksmusik? Das liegt lange zurück, ist vorbei! Kein Volkslieder-Singen im Chor mehr, von zu Hause ausgezogen, kein Musikantenstadl, koa liabste Weis! Gedankensplitter und Stimmen- Chaos im Kopf. [...] Volksmusik in der eigenen Biographie nachspüren, vorerst noch vagen und diffusen Ideen von und zu Volksmusik auf der Spur bleiben, längst Vergessenes wieder entdecken, Widersprüche, die auftauchen, zulassen. [...] Ich denke bei Volksmusik an heitere Menschen, die bei Friede, Freude, Eierkuchen in der Stub'n sitzen Hackbrett spielen und heile Welt spielen. [...] Glaubst Du, dass die Tatsache, dass wir österreichische Volksmusik eher ablehnen, vielleicht mit unserer Vergangenheit zu tun hat? Von Märschen weiß ich beispielsweise, da graust es mir wenn ich sie höre, weil sie mich an Kriege und Gewalt erinnern. [...] Chinesische Musik liegt mir zum Beispiel eher nicht. Aber einen Sirtaki kann ich mir durchaus anhören. Oder irische Volksmusik oder Zigeunerlieder. [...] Es geht mir genau so, als würden meine Geschmacksnerven als Ausgangsposition nur die negativen Schwingungen durchlassen. Aber mich würde trotzdem interessieren, ob mir die Melodie eigentlich gefallen würde. Dich nicht?”[2365]
Die Projekte der Studierenden im Rahmen unseres Projekts zeugen von generationellen Gegensätzen und milieugebundenem Musikerleben: In den qualitativen Interviews einer Projektgruppe wird auf Volksmusik zum Beispiel als „Etwas, was man nicht hören kann” oder als „ländliche Musik, mit der ich persönlich nichts anfangen kann” Bezug genommen. Ob auch Hansi Hinterseer oder die Zillertaler Schürzenjäger Interpreten von Volksmusik sind oder nicht, ist den Befragten völlig gleichgültig. Volksmusik wird von jüngeren Menschen in hohem Maß mit volkstümlicher Musik gleichgesetzt. Die Brüche der neuen Volksmusik mit Traditionen, die ältere Generationen eher brüskieren oder wehmütig stimmen, erreichen leichter die Akzeptanz der Jüngeren.
Das folgende Beispiel ist typisch für die Art und Weise, wie die Aufforderung, über Erfahrungen mit Volksmusik zu erzählen, in eine Erzählung über Generationenspannungen verwandelt wird: „Da meine Eltern voll auf diese Musik [Anm.: volkstümliche Schlagermusik] ‚stehen' und auch auf Volksmusik, und ich aber Schlager schrecklich finde, hatte ich schon sehr oft eine Auseinandersetzung mit ihnen. Jetzt denke ich, bin ich vielleicht schon etwas toleranter, als noch wenige Jahre zuvor, wenn ich diese Art von Musik höre. Mein Vater ist sehr musikalisch, und wenn er in der Werkstatt arbeitet, oder im Garten ist, dann pfeift er meist eine volkstümliche Musik. Da mir diese Musik absolut nicht gefällt, halte ich dieses Pfeifen einfach nicht aus. Oder auch, wenn sich meine Eltern im Fernsehen beispielsweise den ‚Musikantenstadl' ansehen, und ich sitze auch im Wohnzimmer, und mein Vater klopft im Takt dazu, dann bringe ich es nicht zusammen, dass ich nichts sage, sondern werde meistens sehr grantig, ‚fahre' meinen Papa an, was mir hinterher auch wieder leid tut – er hört dann auch zu klopfen auf, weil er weiß, dass ich das überhaupt nicht mag, und gleichzeitig bekomme ich Schuldgefühle, weil ich mir denke, dass ich ein wenig intolerant bin. Oder meine Eltern sehen sich im Fernsehen eine Schlagerparade an, ich komme ins Wohnzimmer, und frage, ob ich mir etwas anderes ansehen darf, und ‚verjage' die beiden dadurch – und das passiert doch sehr häufig. Oder – Mittagessen am Sonntag vor wenigen Jahren – ich war Samstag Abend mit Freunden fort, bin dann meist am Sonntag erst zum Mittagessen aufgestanden – ich komme in die Küche – meine Eltern sitzen beim Essen, und der Radio dröhnt laute Volksmusik/volkstümliche Musik. Oft bin ich gleich zum Radio gestartet, und habe ihn abrupt abgestellt, weil – eh noch unausgeschlafen und dadurch nicht besonders gut drauf, und dann gleich diese Musik! Mein Vater hat mir zwar öfters ins Gewissen geredet, dass ich nicht einfach ausschalten soll, aber wenn ich diese Musik gehört habe/höre, muss ich etwas unternehmen, sonst flippe ich aus.”[2366]
An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, wie biographische Erinnerungen aufgezeichnet werden. Der Generationenstreit hängt sich an der Volksmusik auf und wird als ein Streit gedeutet, bei dem es um Toleranz und Intoleranz geht. Die Volksmusik wird hier nicht als ‚brauchbarer' Träger für einen Generationenkonflikt wahrgenommen, sondern als dessen Ursache. Indem der Generationenkonflikt als Geschmacksstreit gedeutet wird, kann man nur über Toleranz wieder aus dem Streit herausfinden. Mit dieser Deutung kann der Verhandlung von Generationendifferenzen ausgewichen werden, indem die Volksmusik als Streitobjekt „naturalisiert” wird. Darin besteht die Ideologie der Auseinandersetzung über Volksmusik: Dass man so tut, als wäre die Volksmusik selbst das Problem, während es gerade die kulturellen Deutungspraktiken über Volksmusik sind, um die der Streit entbrennt. Generationen- und Geschlechterdifferenzen, ethnische Unterschiede und Klassengegensätze bilden als identitätsstiftende Differenzierungskategorien machtvolle Kategorien, an denen sich Deutungskämpfe entzünden. Reflexive Bearbeitung von Biographien bedeutet nun, dass genau dieses Verhältnis zwischen Volksmusik und kultureller Deutung als ein konstruiertes sichtbar gemacht wird. Erfolgreich ist sie, wenn gelernt wird, dass das Streitobjekt sekundär ist, das heißt, dass sich der Streit letztlich an einem beliebigen Objekt entzünden kann, weil es nicht um Volksmusik geht, sondern um Generationen- und andere Differenzen. Um diese Differenzen verhandeln zu können, müssen wir immer wieder neu Sprachen finden und erfinden, ansonsten werden solche Verhandlungen, die notwendiger Teil von Identitätsbildungsprozessen sind, auf Ersatzobjekte wie die Volksmusik übertragen.
Ebenso verschämt wie Erfahrungen mit Volksmusik in biographischen Erzählungen auftauchen, ist auch das Verhältnis der Erwachsenenbildung zur Volksmusik. Einerseits steht populare Kultur oft im Mittelpunkt lokaler und regionaler Bildungs- und Kulturarbeit, vor allem im Bereich des freiwilligen Engagements in Chören, Musikgruppen, Trachtennähkursen und Ähnliches. Gerne verwendet man ihre Mitgliedschaften für die Statistik der TeilnehmerInnen. Andererseits wird es als ausgesprochenes Wagnis empfunden, Singen, Musizieren und Goldhaubensticken als Erwachsenenbildung zu definieren. FunktionärInnen solcher Vereine bezeichnen ihre Tätigkeiten daher oft bescheidener als „Kulturarbeit”. Auf diese Art tragen sie unbewusst zur Spaltung dieser beiden Bereiche bei. Dazu gehört auch das Bild, dass Erwachsenenbildung mit Lernen in speziell arrangierten, institutionalisierten Lernumgebungen gleichzusetzen sei, das starke Züge des schulischen Lernens als idealtypische Lernform aufweist. Zum verschämten Umgang mit Volksmusik gehört auch eine enge musikalische Definition, die sich an die begriffliche Opposition von Volksmusik und volkstümlicher Musik hält. Auch in unserem Projekt ist diese Entgegensetzung immer wieder aufgetaucht, meist als Pro und Contra „echten” oder „unechten” Geschmacks, für „Stubenmusi” im Gasthaus und gegen Hubert von Goisern auf der Bühne und vor allem gegen Karl Moik und den Musikantenstadl als angefeindeten Gipfel des schlechten Geschmacks.
Genau hier setzt nun das Projekt an, denn über den Weg der Diskussion, was „richtige” und „falsche”, „patriotische” und „interkulturelle”, „neue” und „alte” Volksmusik ist, beginnt eine Auseinandersetzung über Dynamiken, Brüche und Paradoxien gesellschaftlicher Modernisierung, in der sich populare Kultur sehr eng mit zentralen Themen der Bildungsarbeit verwebt: Wie sind regionale und globale, kollektive und personale Identitäten aufeinander bezogen? Wie vertragen sich Bastelbiographien mit herkömmlichen Lebensentwürfen? Welche identitätsstiftende Arbeit leisten Erwachsenenbildungs- und Kulturvereine? Wie gelingt es ihnen, Inklusions- und Exklusionsmechanismen in ländlichen Regionen zu überwinden? Und wie erzeugen sie selbst immer wieder Zugehörigkeit und Ausgrenzung?
In Workshops der Bad Ischler Tagungen zum Thema TraditionenBrüche 2001 und 2002, in denen die Arbeit an Biographien mit Fragen nach künftigen Möglichkeiten von Vereinskulturen verknüpft wurde, zeigte sich der Bedarf an der Verschränkung von Bildungs- und Kulturarbeit: Welche Bedeutung hat Volkskultur für intergenerative Kontakte? Was bedeutet die Abwanderung der Jungen aus dem Ort zu Studium und Beruf? Wie wird die Frage der Macht zwischen Generationen und Geschlechtern abgehandelt? Wie vertragen sich Ironie und die Vorstellung vom „Wahren, Schönen und Guten”? Was macht Gemeinsinn in Vereinen? Wir sehen unser Projekt auch als ein Ausweiten fest gezogener Grenzen, als einen Versuch Richtung „spacing the lines”,[2367] vorsichtig, in offenen Prozessen, deren Ausgang auch uns ungewiss bleibt.
Was also könnte Bildungs- und Kulturarbeit von einem unverschämteren Verhältnis zur Volksmusik gewinnen? Sie könnte sich von dem tief verwurzelten Glauben an die Vorzüge von Institutionen und institutioneller Bildung befreien und sich noch mehr Formen des informellen Lernens bzw. des Lernens „en passent” zuwenden. Sie könnte einen Faden aufgreifen, der zu Lebenslagen und Lebenswelten und deren biographischer Reflexion führt. Erwachsenenbildung könnte auch über den ausgrenzenden Abtausch von Geschmacksrichtungen hinausgehen und die Form der sozialen Räume beleuchten, die das Feld kennzeichnen. Was haben zum Beispiel Fanklubs volkstümlicher Gruppen von ihrem speziellen Hobby? Dieser Frage ging der Tübinger Journalist und Kulturwissenschaftler Ralf Grabowski nach. Er hat seine persönliche Abneigung gegen Bierzeltfeste zum Anlass genommen, eben dort ethnographische Analysen anzustellen.[2368]
Indem sich Erwachsenenbildung diesem Feld annähert, das nicht bereits im vorhinein als Lernfeld definiert ist, kann die Auseinandersetzung mit Volksmusik und den Erfahrungen, die sich an Volksmusik knüpfen dazu beitragen, Erwachsenenbildung einerseits von der starren Unterscheidung von Bildung und Kultur und andererseits von einem überholten schulischen Lehr-Lern-Paradigma befreien. Um zu lernen, muss nicht notwendig auch gelehrt werden. Es wird in Hinkunft vielmehr um genaue Beobachtung des Fremden und um den gelassenen Umgang mit Unkalkulierbarem und Mehrdeutigem gehen.[2369] Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Ralf Grabowski in seinen Untersuchungen: „Es geht hier also (auch) nicht um die musikalische Qualität des volkstümlichen Schlagers, sondern um seinen Sitz im Leben der Konsumenten. […] Im Mittelpunkt [...] steht der aktive Konsument, der mehr oder weniger gezielt die besonderen Erlebnisqualitäten dieser Musikgattung vereinnahmt. Er ‚gebraucht' die Musik, in dem er sie sich in einem gesteuerten Prozess aneignet und sie in seinen lebensweltlichen Kontext einbaut. Hierin erlangt der volkstümliche Schlager als Produkt der Popkultur seine Relevanz. Nicht die Eigenschaft ist wichtig, sondern der Gebrauch durch die verschiedenen Publika. In dieser Blickrichtung erscheinen die ästhetischen Standards nicht mehr wichtig.”[2370]
Darf man das Ebenseer Dirndl nun weiterentwickeln oder nicht? Schon kleine farbliche Nuancen können flammende Appelle gegen ModernisiererInnen oder auch verbissenes Schweigen auslösen. Ironische Reaktionen darauf kippen leicht in Zynismus oder werden so gedeutet. Wenn der Bad Ischler „Verein zur gedemütigten Lederhose” gemeinsam mit dem Trachtenverein, Kameradschaftsbund oder der örtlichen Musikkappelle auftritt, werden auch handfeste lokale Differenzen sichtbar, die sich rund um das Thema „Volksmusik”, „Volkskultur” und „Heimat” gruppieren. Und so gibt es auch in unserem Projekt Brüche, die schier unüberwindbar erscheinen. Nach vorsichtigen Annäherungen zwischen TrachtenträgerInnen und solchen, denen jeder Hirschhornknopf als konservatives Wagnis erscheint, treten die „Landstreich”[2371] mit urban-intellektuellen Dissonanzen auf oder erinnern „Edelschwarz” zwischen Kaskaden von Heavymetal an alte Jodler. Angesichts solcher Abend-„Events” im Leharkino scheinen Avantgarde und Tradition Lichtjahre entfernt. Die, die kommen, sind unter sich. Zugehörigkeiten, Ausgrenzungen und Marginalisierungen scheinen wie eh und je zu funktionieren. Sie lassen sich an Sprache, Moden und Herkunft festmachen. Entscheidend ist aber, dass diese Kategorien je nach Kontext unterschiedlich streng gehandhabt und verschieden gedeutet werden. Zugehörigkeit und Ausschluss definieren sich über bewegliche Grenzen, und es gibt nicht die Autorität, die darüber entscheidet. Und auch scheinbar homogene Gruppen zeigen nach innen Differenzen, Uneinigkeiten, Brüche und Spannungen. Zugehörigkeit erwirbt man sich nicht einmal und besitzt sie, sie muss im Alltag immer wieder neu hergestellt werden.
Bildungs- und Kulturarbeit ist dazu da, sich genau diesen Brüchen und Widersprüchen zu widmen und sie als Ausgangspunkte für Bildungsprozesse aufzunehmen. Genau dies ist, zumindest in Ansätzen, auf den bisherigen zwei Bad Ischler Tagen zur Volksmusik auch gelungen. Es handelt sich nicht um ‚große Schritte' im herkömmlichen Sinn, nicht um die Veränderung politischer Systeme, sondern um Ansätze kulturellen Lernens, das bei alltäglichen (eingeschliffenen) Lebensgewohnheiten, Wahrnehmungsweisen und Denkmustern von Menschen einsetzt. So endete etwa eine Diskussion um die Weiterentwicklung des Ebenseer Dirndls mit der Einsicht, dass Ironie nicht nur als destruktives Muster verstanden werden muss, sondern auch einen positiven Wert darstellen kann, weil sie eine fragile, aber doch gangbare Brücke zwischen den Generationen schlagen könnte. Das symbolträchtige Objekt, das ironisch zitiert wurde: ein von einer Schülerin der Modeschule in Ebensee genähtes Dirndl mit aufgenähten Franz-Josef-Münzen – weit weg vom Ebenseer Dirndl und auf den ersten Blick unauffällig. Mit spielerischem Ernst begegnet es der Betrachtung durch die zum Teil fest eingebunkerte Tradition und setzt verhärteten Grenzziehungen und geronnenen Differenzen eine erfrischende Leichtigkeit entgegen, mit der Veränderungen anheben.
Verwendete Literatur:
Die Landstreich: Stau. CD 2001.
Raunig, Gerald: Spacing the Lines – Der Boden unter den Füßen des Populismus. http://www.gettoattack.net/intervention/archivpapier/raunig.htm (30. Oktober 2002). [Anm.: Zum Zeitpunkt der Publikation nicht mehr online.]
Streeruwitz, Marlene: Heimat. http://www.kultur.at/3house/erz/streerheim/ (31. Oktober 2002). [Anm.: Zum Zeitpunkt der Publikation nicht mehr online.]
Projektdokumentationen:
[Arnold/Siebert 1999] Arnold, Rolf; Horst Siebert: Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Von der Deutung zur Konstruktion von Wirklichkeit. Hohengehren 1999.
[BauerWa 2001] Bauer, Wally: Da wurde erst recht gesungen. In: In: Muthesius, Dorothea (Hg.): „Schade um all die Stimmen“. Erinnerungen an Musik im Alltagsleben. Wien 2001 (Damit es nicht verlorengeht ... 46), S. 104–107.
[Berg/Fuchs 1993] Berg, Eberhard; Fuchs, Martin (Hg.): Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographischen Repräsentation. Frankfurt am Main 1993.
[Bromley/Göttlich/Winter 1999] Bromley, Roger; Göttlich, Udo; Winter, Carsten (Hg.): Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung. Lüneburg 1999.
[Dallinger 2002] Dallinger, Klaudia: Im Märzen der Bauer, Rüstbaum-Walzer, Hubert von Goisern, Sirtaki & Co. Über differente Vorstellungen von Volksmusik. In: ÖIEB-News. Aktuelle Informationen des Österreichischen Instituts für Erwachsenenbildung, Sondernr.: TraditionenBrüche 2001. St. Pölten 2002, S. 6 f.
[Fiske 2000] Fiske, John: Lesarten des Populären. Wien 2000.
[Forster 2002] Forster, Edgar J.: TraditionenBrüche – Zugänge zu einem Projekt über Volksmusik. In: Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung (Hg.): ÖIEB-News. Aktuelle Informationen des Österreichischen Instituts für Erwachsenenbildung, Sondernr.: TraditionenBrüche 2001. St. Pölten 2002, S. 4 f.
[Geertz 1987] Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. 1. Aufl. Frankfurt am Main 1987 (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 696).
[Grabowski 1999] Grabowski, Ralf: Zünftig, bunt und heiter. Beobachtungen über Fans des volkstümlichen Schlagers. Tübingen 1999.
[Grossberg 1999] Grossberg, Lawrence: Zur Verortung der Populärkultur. In: Bromley, Roger; Göttlich, Udo; Winter, Carsten (Hg.): Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung. Lüneburg 1999, S. 215–236.
[Grossberg 2000] Grossberg, Lawrence: What's going on? Cultural Studies und Popularkultur. Wien 2000 (Cultural Studies 3).
[Hall 2000b] Hall, Stuart: Postmoderne und Artikulation. In: Hall, Stuart: Cultural Studies – Ein politisches Theorieprojekt. Ausgewählte Schriften 3. Hamburg 2000, S. 52–77.
[Hoggart 1999] Hoggart, Richard: Die „wirkliche“ Welt der Leute. Beispiele aus der populären Kunst. In: Bromley, Roger; Göttlich, Udo; Winter, Carsten (Hg.): Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung. Lüneburg 1999, S. 43–56.
[Lacan 1990] Lacan, Jacques: Freuds technische Schriften. Das Seminar. Buch I. Weinheim [u. a.] 1990.
[Lutter/Reisenleitner 1998] Lutter, Christina; Reisenleitner, Markus: Cultural Studies. Eine Einführung. Wien 1998.
[Muthesius 2001] Muthesius, Dorothea: „Schade um all die Stimmen ...“. Erinnerungen an Musik im Alltagsleben. Wien 2001 (Damit es nicht verlorengeht 46).
[SchulzeTh 1991] Schulze, Theodor: Pädagogische Dimensionen der Biographieforschung. In: Hoerning, Erika M. [u. a.]: Biographieforschung und Erwachsenenbildung. Bad Heilbronn 1991, S. 135–181.
[SteinerA 2002] Steiner, Anita: „Aber trotzdem habe ich mich mit dieser Musik noch immer nicht angefreundet.“ Meine Erinnerungen an Volksmusik. Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung (Hg.): ÖIEB-News. Aktuelle Informationen des Österreichischen Instituts für Erwachsenenbildung, Sondernr.: TraditionenBrüche 2001. St. Pölten 2002, S. 12f.
[Wollner 2001] Wollner, Erna: Ich perlte – zu Mamas Missvergnügen. In: Muthesius, Dorothea (Hg.): „Schade um all die Stimmen ...“. Erinnerungen an Musik im Alltagsleben. Wien 2001 (Damit es nicht verlorengeht ... 46), S. 129–144.
[Wulf/Zirfas 2001] Wulf, Christoph; Zirfas, Jörg: Das Soziale als Ritual: Perspektiven des Performativen. In: Wulf, Christoph [u. a.]: Das Soziale als Ritual. Zur performativen Bildung von Gemeinschaften. Opladen 2001, S. 339–347.
[Wulf/Göhlich/Zirfas 2001] Wulf, Christoph; Göhlich, Michael; Zirfas, Jörg (Hg.): Grundlagen des Performativen. Eine Einführung in die Zusammenhänge von Sprache, Macht und Handeln. Weinheim [u. a.] 2001.
[ÖIEB 2002] Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung (Hg.): ÖIEB-News. Aktuelle Informationen des Österreichischen Instituts für Erwachsenenbildung, Sondernr.: TraditionenBrüche 2001. St. Pölten 2002.
[Pöllinger Briefe] Pöllinger Briefe. Zeitschrift der Arge Region Kultur und des Ringes Österreichischer Bildungswerke 66 und 67 (2001).
[2342] Unter dem Titel TraditionenBrüche haben wir in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Institut für Erwachsenenbildung (ÖIEB) in St. Pölten, dem Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Salzburg 2001, dem Institut für Volkskultur des Landes OÖ, der Stadt Bad Ischl, dem oö. Volksbildungswerk und der Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien ein regionales Projekt zum Thema Volksmusik durchgeführt. Es umfasste eine Reihe von Initiativen: Im Sommersemester 2001 führten Hubert von Goisern und Edgar Forster am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Salzburg eine Lehrveranstaltung zur biographischen Arbeit mit Volksmusik durch. Ergänzt wurde dieses Seminar durch studentische Feldstudien über Einstellungen zur Volksmusik. Den Abschluss bildeten eine öffentliche Tagung zum Thema TraditionenBrüche und ein Konzert zu „Neuer Volksmusik” in Bad Ischl, die schließlich 2002 in eine Folgeveranstaltung mündete. Das Gesamtprojekt ist als Sondernummer der ÖIEB news und in einem Schwerpunktheft der Pöllinger Briefe dokumentiert: [ÖIEB 2002]; [Pöllinger Briefe] 66 und 67 (2001).
[2344] Vgl. einführend [Bromley/Göttlich/Winter 1999]; [Lutter/Reisenleitner 1998]. Relevant für unser Thema sind außerdem Texte zur Analyse von Populärkultur, etwa: [Fiske 2000]; [Grossberg 2000].
[2345] Vgl. [Berg/Fuchs 1993]; [Geertz 1983].
[2346] Vgl. [Lutter/Reisenleitner 1998], S. 10.
[2347] [Geertz 1987], S. 9.
[2348] Vgl. [Hoggart 1999].
[2349] [Grossberg 1999], S. 217.
[2350] Vgl. [Grossberg 2000], S. 54f.
[2351] Vgl. [Wulf/Zirfas 2001]; vgl. auch [Wulf/Göhlich/Zirfas 2001].
[2352] "Ich gebrauche immer das Wort ‚Artikulation', obwohl ich nicht weiß, ob die Bedeutung, die ich ihm gebe, genau verstanden wird. In England hat das Wort eine schöne Doppelbedeutung, weil ‚artikulieren' sprechen bedeutet, zum Ausdruck bringen, artikuliert sein. Es hat die Bedeutung von ausdrücken, Sprache formen. Aber wir sprechen auch von einem verkoppelten (articulated) Lastwagen: Ein Lastwagen, bei dem das Führerhaus mit einem Anhänger verkoppelt sein kann, aber nicht muss. Die beiden Teile sind miteinander verbunden, aber durch eine bestimmte Art der Verkoppelung, die gelöst werden kann. Eine Artikulation ist demzufolge eine Verknüpfungsform, die unter bestimmten Umständen aus zwei verschiedenen Elementen eine Einheit herstellen kann. Es ist eine Verbindung, die nicht für alle Zeiten notwendig, determiniert, absolut oder wesentlich ist. Man muss sich fragen, unter welchen Bedingungen kann eine Verbindung hergestellt oder geschmiedet werden? Die so genannte ‚Einheit' eines Diskurses ist in Wirklichkeit die Artikulation verschiedener, unterschiedlicher Elemente, die in sehr unterschiedlicher Weise reartikuliert werden können, weil sie keine notwendige ‚Zugehörigkeit' haben.” ([Hall 2000b], S. 65).
[2353] Vgl. Streeruwitz, Marlene: Heimat (blatt 1). http://www.kultur.at/3house/erz/streerheim/ (31. Oktober 2002). [Anm.: Zum Zeitpunkt der Publikation nicht mehr online.]
[2354] Vgl. [SchulzeTh 1991], S. 136f.
[2355] Vgl. [Lacan 1990], S. 20.
[2356] [Muthesius 2001], S. 360.
[2357] [Muthesius 2001], S. 360.
[2358] [Muthesius 2001], S. 10f.
[2359] [Muthesius 2001], S. 44.
[2360] [Muthesius 2001], S. 45.
[2361] [Muthesius 2001], S. 13.
[2362] [Wollner 2001], S. 130.
[2363] [Muthesius 2001], S. 364.
[2364] [BauerWa 2001], S. 105.
[2366] [SteinerA 2002], S. 12.
[2367] Vgl. Raunig, Gerald: Spacing the Lines – Der Boden unter den Füßen des Populismus. http://www.gettoattack.net/intervention/archivpapier/raunig.htm (30. Oktober 2002). [Anm.: Zum Zeitpunkt der Publikation nicht mehr online.]
[2368] [Grabowski 1999].
[2369] Vgl. [Arnold/Siebert 1999], S. 106.
[2370] [Grabowski 1999], S. 16.
[2371] Die kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Texten taucht in allen ihren Liedern auf, etwa in „männergruppe” auf der CD „Stau”. Die vierte Strophe lautet: „Wie versuchen uns zu lösen / Von allen bösen maskulinen Blößen / Wir lernen küssen, streicheln, kuscheln / Tratschen, quietschen, nuscheln / Bügeln, schrubbern, wetzen / Beim Ludln niedersetzen.”