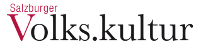

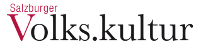

HIER gelangen Sie zur Langtext-Version dieses Beitrags.
Unter dem Titel „TraditionenBrüche“ haben wir in Zusammenarbeit mit Hubert von Goisern, der Universität Salzburg und verschiedenen Kulturinitiativen und Erwachsenenbildungseinrichtungen ein regionales Projekt zum Thema Volksmusik durchgeführt. Es umfasste eine Reihe von Initiativen: ein Seminar an der Universität Salzburg, Feldstudien von Studierenden zum Thema Volksmusik, eine Tagung und ein Konzert in Bad Ischl im Juni 2001.[147]
Im Mittelpunkt des Projekts „TraditionenBrüche“ stand Volksmusik nicht als musikalische Tradition, sondern als Teil von Alltagskultur. Wir waren und sind daran interessiert, welche lebensgeschichtlichen Erfahrungen Menschen mit Volksmusik verbinden und für welche Werte und Orientierungen Volksmusik in der Gesellschaft steht.
Wir haben uns deshalb auf zwei Fragen konzentriert: Warum entzünden sich am Geschmack über Volksmusik immer wieder Diskussionen zwischen jungen und alten Menschen, zwischen Tradition und modernem Leben? Was bedeutet dieses Spannungsfeld für Vereine, vor allem für traditionelle Vereine, die als wichtig angesehen werden für regionale Volkskulturen, zugleich aber mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben?
„Volksmusik riecht nach dem verbrannten Kaffee meiner Großmutter“, heißt es in einer Aufzeichnung.[148] Damit soll gesagt werden, dass die Volksmusik Menschen in ihrem Alltag begleitet. Wenn die Menschen Volksmusik hören, bemerken sie, dass die Musik mit vielen Familien- und anderen Lebensgeschichten verbunden ist.
Volksmusik ist ein Speicher für Erinnerungen von Bildern, Gerüchen, Stimmungen, Ängsten und Glücksmomenten, die auf diese Weise als Teil unserer Biografie weiterleben, uns verändern und zu dem machen, was wir sind. Aber davon wissen wir nichts. Es bleibt nur eine Spur: Volksmusik gefällt mir oder ich finde sie unausstehlich. Meistens ist sie beides, ein Entweder-oder gibt es selten.
Unser Augenmerk legen wir auf die Frage, warum Volksmusik und einzelne darum herum gruppierte volkskulturelle Traditionen in der Lage sind, die Menschen in heftige Befürworter/innen und Gegner/innen zu spalten, sie emotionell für oder gegen Volksmusik aufzubringen. Dabei ist es von Interesse, dass unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Zugänge zur Volksmusik entwickeln, Unterschiedliches zur Volksmusik hinzurechnen und unterschiedliche Volkskulturen mit gänzlich unterschiedlichen Zuschreibungen versehen. Immer beschreibt Volksmusik ein machtvolles Feld mit Grenzziehungen, mit Inklusionen und Exklusionen. Solcherart wird nicht nur Fremdes, sondern auch das Eigene konstruiert.
Wenn Volksmusik ein Speicher für Erinnerungen ist, dann kann man aus Volksmusik auch etwas lernen. Genau das haben wir im Rahmen des Projekts „TraditionenBrüche“ versucht, indem wir die Arbeit in den Vereinen mit dem Nachdenken über Volksmusik und die Bedeutung, die sie im Leben von Menschen hat, verknüpft haben. Daraus ist unser Anspruch an Bildung entstanden, den wir so begreifen:
Es kommt darauf an, alltägliche Praktiken zu reflektieren und zu verändern, neue Sicht- und Denkweisen zu entwickeln und damit eingeschliffene Handlungsweisen kritisch zu beleuchten. Entscheidend ist, dass diese Form der Bildung auf alle Sinne zielt. Das bedeutet, dass mit Seh-, Hör-, Geschmacks- und Tastgewohnheiten gespielt wird. Das eröffnet dem Einzelnen neue Handlungsmöglichkeiten.
Für solches Lernen eignet sich Musik besonders gut. Mehr als andere Themen aktualisiert und integriert sie alte Erfahrungen: „Das eine ist die Ebene der Emotionalität. Musik reproduziert diese Emotionalität sehr genau, und dies entspricht der subjektiven Empfindung, dass die Emotionen gewissermaßen zeitlos sind, nicht altern.“[149] Es kommt dazu, dass Musik greifbarer ist als Gedanken, Einstellungen und Werte, aber nicht so materiell wie andere erinnerungsträchtige Gegenstände wie Möbel, Kleidungsstücke oder Fotos. Aus diesen Gründen ist Musik ein besonders guter Erinnerungsträger.
Erinnerungen an die Musik der Kindheits- und Jugendphase sind besonders eindrücklich. Daraus erklärt sich, warum Unterschiede zwischen Generationen deutlich hervortreten: Sie verbinden mit ihrer Musik völlig unterschiedliche Alltagserfahrungen. Diese sind vor allem durch weitere Unterschiede geprägt: unterschiedliche Erfahrungen zwischen Männern und Frauen und zwischen unterschiedlichen Milieus und Regionen.
Das folgende Beispiel ist typisch für die Art und Weise, wie die Aufforderung, über Erfahrungen mit Volksmusik zu erzählen, rasch zu einem Gespräch über einen Generationenkonflikt wird: „Da meine Eltern voll auf diese volkstümliche Schlagermusik ‚stehen‘ und ich aber Schlager schrecklich finde, hatte ich schon sehr oft eine Auseinandersetzung mit ihnen. Wenn sich meine Eltern im Fernsehen beispielsweise den ‚Musikantenstadl‘ ansehen, und ich sitze auch im Wohnzimmer, und mein Vater klopft im Takt dazu, dann bringe ich es nicht zusammen, dass ich nichts sage, sondern werde meistens sehr grantig, ‚fahre‘ meinen Papa an, was mir hinterher auch wieder leid tut – er hört dann auch zu klopfen auf, weil er weiß, dass ich das überhaupt nicht mag, und gleichzeitig bekomme ich Schuldgefühle, weil ich mir denke, dass ich ein wenig intolerant bin.“[150]
Wenn man daraus lernt, dass es nicht um Volksmusik geht, sondern um die Unfähigkeit von jungen und alten Menschen, eine gemeinsame Sprache zu finden, in der sie über ihre Probleme sprechen können, dann wäre die Auseinandersetzung mit Volksmusik geglückt.
Was kann Bildungs- und Kulturarbeit von einem weniger verschämten Verhältnis zur Volksmusik gewinnen? Hier setzt das Projekt „TraditionenBrüche“ an, denn über den Weg der Diskussion, was „richtige“ und „falsche“, „patriotische“ und „interkulturelle“, „neue“ und „alte“ Volksmusik ist, beginnt eine Auseinandersetzung über den Wert von örtlichen Trachtenvereinen und Musikkapellen für die Entwicklung von Gemeinschaften. Es beginnt eine Auseinandersetzung über „richtige“ Lebensweisen. Damit wird sichtbar, wie etwa in vielen Umlandgemeinden von Salzburg Grenzen zwischen Alteingesessenen und „Neuen“ gezogen werden, wie Zugehörigkeiten geschaffen werden und wie dadurch Ausgrenzung passiert. Es zeigen sich dann auch rasch Brüche, die nicht von außen kommen, sondern sich durch das scheinbar harmonische Gemeindeleben ziehen.
In Workshops der Bad Ischler Tagungen 2001 und 2002 haben wir gezeigt, dass Erwachsenenbildung hier eine wichtige Aufgabe hat. Sie ist nicht nur auf schulisches Lernen beschränkt und sie findet nicht nur in den Räumen von Volkshochschulen statt. Wenn Lernen etwas mit eigenen Lebensgeschichten und mit der Entwicklung von Gemeinschaften zu tun haben soll, dann verschränken sich Bildungs- und Kulturarbeit: Welche Bedeutung hat Volkskultur für das Zusammenleben von Generationen und unterschiedlichen ethnischen Gruppen? Was bedeutet die Abwanderung der Jungen aus dem Ort zu Studium und Beruf? Welche Aufgaben haben Traditionsvereine heute? Und wie lassen sich junge Menschen für die Gestaltung von Gemeinden und Regionen gewinnen?
Darf man das Ebenseer Dirndl nun weiterentwickeln oder nicht? Schon kleine farbliche Nuancen können flammende Appelle gegen Modernisierer/innen oder auch verbissenes Schweigen auslösen. Wenn der Bad Ischler „Verein zum Schutze der gedemütigten Lederhose“ gemeinsam mit dem Trachtenverein, Kameradschaftsbund oder der örtlichen Musikkapelle auftritt, werden auch handfeste lokale Unterschiede sichtbar, die sich rund um das Thema „Volksmusik“, „Volkskultur“ und „Heimat“ gruppieren.
Bildungs- und Kulturarbeit ist dazu da, sich genau diesen Brüchen und Widersprüchen zu widmen und sie als Ausgangspunkte für Bildungsprozesse aufzunehmen. Genau dies ist, zumindest in Ansätzen, auf den bisherigen Bad Ischler Tagen zur Volksmusik auch gelungen. Es handelt sich nicht um „große Schritte“ im herkömmlichen Sinn, nicht um die Veränderung politischer Systeme, sondern um Ansätze kulturellen Lernens, das bei alltäglichen (eingeschliffenen) Lebensgewohnheiten, Wahrnehmungsweisen und Denkmustern von Menschen einsetzt.
[147] Das Gesamtprojekt ist als Sondernummer der ÖIEB news und in einem Schwerpunktheft der Pöllinger Briefe dokumentiert: [ÖIEB 2002] und [Pöllinger Briefe] 66/67 (2001).
[149] [Muthesius 2001], S. 360.
[150] [SteinerA 2002], S. 12.