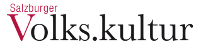

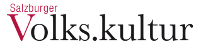

HIER gelangen Sie zur Langtext-Version dieses Beitrags.
Von Anbeginn an war die technische Erschließung des Gebirges Gegenstand von Kontroversen. Doch die Begeisterung für die neuen Verkehrsmöglichkeiten und ihre skeptische Ablehnung sind Erscheinungen, die gleichzeitig ablaufen.
Eine neue Epoche der Bergwahrnehmung leitete Anfang des 20. Jahrhunderts die Seilbahn von Bozen nach Kohlern ein – eine erfolgreiche Adaptierung einer bestehenden Materialseilbahn auf das Bozener Mittelgebirge für den Personenbetrieb. Diese erste Seilschwebebahn erzwang von den Passagieren einen dem Tal zugewandten Blick und beförderte sie mit dem Rücken zum Berg. Erst 1926 konnten – nach dem Ersten Weltkrieg – wieder Seilbahnbauten realisiert werden: Sie entstanden in großem Tempo, einem regelrechten Boom folgend.
Die Seilbahnfahrt kann neben der Luftfahrt als lautlose, schwebende Form der Fortbewegung aufgefasst werden. Die Erweiterung des Horizonts und der touristischen Möglichkeiten ist das meistbestaunte Moment einer Seilbahnfahrt und in der Folge naturgemäß beliebtes Argument für den Bau weiterer Bahnen.
Der Bau der Seilbahnen fand den Widerspruch der eingeschworenen Alpinisten. Dabei ging es um weit mehr als um die Angst vor dem Verlust angestammter Bergeinsamkeit. Vielmehr scheint der Anstieg ohne Schweiß und ohne Anstrengung die in jahrzehntelanger alpinistischer Praxis und Selbstvergewisserung mühsam definierten idealen Motive außer Kraft zu setzen. Aus diesem Grund kam es zu zahlreichen Protestversammlungen.
Wie im gesamten Wirkungskreis des Heimatschutzes neigte man – anstatt Projekte grundsätzlich zu bekämpfen – zu „angemessener Ausführung“. Farblich angepasste Gittermasten (keinesfalls Betonmasten), Mitsprache bei der Gestaltung der Stationsgebäude, Einhaltung bestimmter Form- und Materialzitate waren die neue heimatschützerische Doktrin. Mit der Planung von Seilbahnen wurden weitgehend dem Heimatschutz eng verbundene Architekten beauftragt.
Die Seilbahnunternehmen selbst sind – offensichtlich im Einvernehmen mit ihrem Publikum – darangegangen, aus der Kulturgeschichte der Seilbahnfahrt einen neuen Mythos zu wirken: In Kitzbühel, Bregenz und anderswo warten Seilbahnmuseen auf Besucher/innen, auf der Zugspitze werden Ausstellungen gezeigt und historische Gondeln werden zum musealen Aufputz der Parkplätze und Skiflächen.
HIER gelangen Sie zur Langtext-Version dieses Beitrags.
Im Tourismus lauert die Gefahr, dass der unreflektierte Umgang einander fremder Besucher und Dienstleister zu sozialen und kulturellen Konflikten führt. Aus volkskundlicher und psychologischer Perspektive werden Grundlagen zur Frage nach „authentischem“ versus „modernistischem“ Alpen-Erleben erarbeitet. „Echt“, „alt“, „bodenständig“ erweisen sich als Reflexionsbegriffe, die mehr über die Wünsche der Reisenden als über das Zustandekommen der lokalen Phänomene aussagen.
Tourismus setzt sich vom (vorher herbeigeredeten) „grauen Alltag“ ab und erstrebt Kontrasterlebnisse „in den schönsten Wochen des Jahres“. Da sich Massentourismus und kulturelle „Insellage“ gegenseitig ausschließen, wird die Balance aus Erlebnissen für die Touristen sowie Menschenwürde und Selbstbestimmung für die Einheimischen angestrebt. „Nachhaltiger“ Tourismus definiert sich nicht über das Erlebnis, sondern über das Mit- und Nebeneinander von Wirtschaft, Lebensraum und Kultur als ethischer Aufgabe.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug aus dem Buch „Almsommer“ von Walter Mooslechner (© 2002 Verlag Anton Pustet, ISBN 3-7025-0455-9). HIER geht es zur Autorenseite von Walter Mooslechner beim Verlag Anton Pustet.
Wo in den Alpen die steileren Talhänge in hochgelegene Verflachungen übergehen, beginnt die Almregion. Ihre Gewinnung als Kulturlandschaft ist vielfach älter als die Besiedelung der Talböden, die lange Zeit versumpft, feucht und unwirtlich blieben. Dagegen reicht die alpine Almwirtschaft, wie Pollendiagramme und Bodenfunde beweisen, bis ins 4. vorchristliche Jahrtausend zurück. Ihre Entwicklung hängt eng mit der alpinen Klimageschichte zusammen. Drastische Rückschläge für die Almwirtschaft brachte die Klimaverschlechterung im 16. und 17. Jahrhundert („Kleine Eiszeit“). Viele Hochalmen mussten damals aufgegeben werden. Im Gegensatz zu heute hatte ursprünglich die Almwirtschaft und Nutzung der Bergweiden den Vorrang, die Winterhaltung des Viehs in den tieferen Lagen war hingegen eine bloße Notwendigkeit.
Heute unterscheidet man Almen im Einzeleigentum, Gemeinschaftsalmen, Genossenschaftsalmen sowie Berechtigungsalmen. Nach wie vor gilt dabei der alte Bauernspruch: „Die Alm ist der Kopf eines Bauernlehens.“ Denn Almen entlasten die Heimbetriebe während der Sommerzeit und ermöglichen die Haltung größerer Viehstände. Das im Tal gewonnene Futter kann für die Winterhaltung aufbewahrt werden. Dazu kommt die hervorragende Wirkung des Almsommers auf den Gesundheitszustand der Tiere. Die Salzburger Almen sind durch Rodungstätigkeit im späteren Mittelalter entstanden. Auf einen besonderen Reichtum an Almen kann dabei der Pinzgau verweisen. 2003 gibt es im Bundesland Salzburg 2.300 Almen und 1.800 Almbewirtschafter, denen immer mehr eine Bedeutung als Landschaftspfleger zukommt.
Das Großarltal ist mit über 27 Kilometern eins der längsten Tauerntäler, es zieht sich vom Bezirksort St. Johann im Pongau bis hin zum gletscherbedeckten Keeskogel. Das landschaftlich reizvolle Gebiet am Talschluss ist heute Teil des Nationalparks Hohe Tauern. Der mit 2.885 m höchste Berg trägt mit dem Gstößkees den einzigen Talgletscher.
Auch am Fuße dieses Talgletschers blühte vor Jahrhunderten die Almwirtschaft, erst die Klimaverschlechterung im 17. Jahrhundert und die in Folge vorstoßende Gletscherbildung führte zur Auflassung mehrerer Almen. Um die bedeutendsten Kupfervorkommen des Tals zu erschließen, ließ Fürsterzbischof Johann Jakob Kuen von Belasy im Jahre 1566 hoch über der Schlucht der berühmten Liechtensteinklamm ein „Sträßlein in den Fels“ hauen. In jener Zeit waren viele Bauernlehen im Besitz der Salzburger Kirche und ihre Almen zinsten zum Bergwerk der Erzbischöfe. Besonders ertragreichere Almen dienten zur Versorgung der Bergknappen. Lorenz Hübner weist 1796 noch 63 Almen und einen Viehstand von 1.147 Kälbern, 44 Spinnern (ein- bis zweijährige Stierkälber), 19 Terzen (dreijährige Stiere), 99 Zuchtstiere, 1.801 Kühe, 343 Kalbinnen, 140 Pferde und 4.022 Schafe und Ziegen aus.
Erst die Technisierung des 20. Jahrhunderts versetzte der Almwirtschaft auch im Großarltal einen schweren Rückschlag. In den letzten Jahrzehnten ist eine deutliche Trendumkehr eingetreten. Die Öffentlichkeit hat den unschätzbaren Nutzen der Almwirtschaft erkannt und dazu entsprechende Förderungsmittel bereitgestellt. 2003 kann Großarl wieder auf 37 bewirtschaftete Almen verweisen.
Die Landwirtschaft hat neben dem Bergbau in der Talgeschichte des Gasteinertales einen erheblichen Stellenwert (Versorgung von Knappen, Fuhrleuten, Händlern). Die Schwaigenwirtschaft erreichte im 12. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Zur selben Zeit entstanden durch Waldrodungen viele Almen. Geltung von europäischer Reichweite hatte Gastein auch als Kurort. Seine heißen Quellen zogen schon im Mittelalter Adelige und Standespersonen, aber auch viele mittellose Kranke, die Heilung suchten, an. Seit der Biedermeierzeit – als die Alpenbegeisterung breitere Schichten erreichte – stieg Gastein zum Nobelkurort auf.
Aufgrund reicher Erzvorkommen kann das Rauriser Tal auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurückblicken. Eingebettet in die Bergwelt des Sonnblickmassivs, gehört es mit weiten Teilen zum Nationalpark Hohe Tauern. Schon seit frühester Zeit kannten Säumer, Händler, Wanderer und auch Schmuggler mehrere Übergänge nach dem Süden.[249] Die Notunterkünfte der Säumer lagen jeweils unterhalb der hochalpinen Pässe und waren ursprünglich aus sogenannten Schwaigen hervorgegangen – das waren Almen aus dem Besitz des Erzbischofs.
Der Sattel zwischen dem Mühlbachtal und dem in Richtung Bischofshofen liegenden Gainfeld wird als Mitterberg bezeichnet. Hier am Fuße des Hochkönigmassivs bestand bereits vom dritten bis ersten vorchristlichen Jahrtausend eine geordnete Almwirtschaft. Das Mitterberger Almgebiet ist mit dem Bergbau so eng verbunden wie kaum eine andere Alm.
Im Lungau wurden die Almen schon in früher Zeit genutzt, da die versumpften, unwirtlichen Talböden und dicht bewaldeten Täler für die Viehwirtschaft zunächst ungeeignet waren.
Auf den Spuren der Römer benützten Händler, Säumer und Pilger ab dem 10. Jahrhundert die Handelswege zwischen Nord und Süd. Bis Anfang des 16. Jahrhunderts erreichte der transalpine Handel seinen Höhepunkt. Um diesen schwunghaften Handel zu sichern, ließ Erzbischof Leonhard von Keutschach den Saumweg über den Radstädter Tauern und den Katschberg zum Fahrweg ausbauen. Dieser wirtschaftliche Aufschwung wirkte sich auch vorteilhaft auf die Lungauer Vieh- und Almwirtschaft aus.
Um die extremen Steilanstiege der Passstraße zu überwinden, heuerten die Fuhrleute bäuerliche Anrainer für Schleppdienste an. Den schweren Frachtwagen wurden bis zu 20 Ochsen vorgespannt. Dies brachte der Viehzucht im Lungau neue Impulse und erklärt auch die Existenz der vielen „Ochsenalmen“ im Bezirk. Einen besonderen Reichtum an Almen weist das Zederhaus- und Murtal auf. Je nach Besitz- und Wirtschaftsverhältnissen bestehen im Lungau Einzelalmen oder Almhüttendörfer.
Nach dem Rückzug des Winters von den Gipfeln der Berge in die Gletschergebiete wird das Vieh auf die Hochalmen getrieben. Der Tag der Almfahrt (Mittelhochdeutsch „varn“ = „gehen, reisen“) wurde früher als Festtag angesehen. Gebietsweise war es Brauch, die am Morgen gemolkene Milch an Arme zu verschenken, um Glück und Segen für den Almsommer zu sichern. Um Unglück zu vermeiden, bekamen die Tiere auch geweihtes Salz, Palmzweige, Palmkätzchen, Brot, Kleie und Kräuterpulver.
Am Morgen des Almauftriebs herrscht stets reges Treiben, da es für den langen Almsommer viele Vorbereitungen zu treffen gilt. Geschirr, Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel werden auf Pferdewägen oder auf die Saumtiere aufgeladen. Dann wird das Vieh vom „Heimlehen“ auf die nieder liegenden Früh- oder Voralmen gebracht. Nicht selten führt der Almweg über steiles Gelände und durch wilde Schluchten. Gerade die Tauerntäler weisen in Höhenlagen bis etwa 1.900 m gefährliche Steilhänge auf.
Um die Bewirtschaftung der Almen auch in Zukunft zu sichern, wurden in den letzten Jahrzehnten viele Zufahrtswege errichtet. Das Vieh wird daher heute vielfach mit Fahrzeugen auf die Almen gebracht. So bleibt nur die Erinnerung an die einst „fröhliche Almfahrt“ mit dem hell klingenden Glockengeläute, das weit übers Land zu vernehmen war.
Ein Brauch, der sich in gewissen Regionen bis heute erhalten hat, ist das Schnurausbacken. Aus Mehl, Rahm, Butter, Eiern, Schnaps, Salz und Zucker kneten die Frauen den Teig für dieses besondere Gebäck. Der fertige Teig wird so lange gedreht und „gewuzelt“, bis die Teigstücke eine bestimmte Form und Stärke haben. Die fertigen Teigstücke werden in kleine Scheiben geschnitten und dann in Butterschmalz ausgebacken. Der Schnuraus wird nur zum Almabtrieb gebacken und bei der Heimfahrt an Schaulustige, in erster Linie aber an die Kinder verteilt. Das Wort „Schnuraus“ deutet auf ein plötzliches Abschiednehmen. Im Wort klingt das schnurrende Geräusch an, mit dem ein flüchtiger Vogel forteilt.
Der Arrausch ist ein kugeliges, etwa erbensgroßes Brandteiggebäck. Es hielt sich lange und kam oft noch zu Weihnachten, zusammen mit „fetter Tunch“, also mit Schlagobers, auf den Tisch.
Auf den Lungauer Almen gab es zur Almabfahrt noch eine weitere Spezialität, das Rahmkoch. Aus Mehl und dem gezuckerten Rahm der letzten drei Almtage bereitete die Sennerin zuerst „Farfelbrock’n“. Das Mehl wird dabei mit kaltem Rahm abgebröselt. Nebenbei wird eine größere Menge Rahm so lange gekocht, bis die Milch verdunstet. Dann kommen die Farfeln hinein. Nach Beigabe von etwas Zucker rührt man die Masse, bis sie nicht mehr am Kochlöffel hängen bleibt und schöpft diese in den hölzernen Rahmkochstotz. Nach Beigabe von Zucker, Zimt, Weinbeeren und Anis lässt man die Kochmasse kalt werden.
Mit dem Almleben und Almabtrieb eng verbunden war der einst im Oberpinzgau gebräuchliche „Alperer“. Mit sogenannten Büllhörnern (büllen = brüllen, heulen) verständigten sich die Burschen von Bramberg, Wald, Neukirchen und Krimml am Vorabend (10. November) von Martini zum gemeinsamen Aufbruch. Schreiend wanderten sie von Hof zu Hof. Dazu wurde eine Art Volksgericht („Rügegericht“) abgehalten, bei dem besondere Ereignisse, Dummheiten oder Liebesgeschichten der Almleute und Dorfbewohner zur Sprache kamen. Auch die verschiedenen Laute des Almviehs wurden nachgeahmt. Dazu trugen die Burschen zum Beispiel Doppelfedern am Hut, die Viehhörner symbolisieren sollten.
Ein Brauch, der dem Alperer sehr ähnlich ist, war das im 18. Jahrhundert noch aufgeführte Kühtreiben im Pongau. Am Abend des Johannistages (24. Juni) marschierte unter großer Anteilnahme der Bevölkerung eine Schar von Bauernburschen mit aus Papier gefertigten und von innen mit Lampen beleuchteten Kuh- und Pferdeköpfen durch den Markt St. Johann im Pongau und ahmte damit scherzhaft einen Almabtrieb nach.
In der „Beschreibung des Erzstiftes Salzburg“ berichtete Lorenz Hübner 1796 über die Kühtreiber aus Goldegg: „Wenn sie bei einem Hause still halten, welches sie wässern nennen, so führt der Bauer mit dem Melker ein Gespräch, worin alles das, was in diesem Haus Unschickliches vorgegangen ist, mit einem plumpen Witz angebracht wird.“ Der Brauch des Kühtreibens wird seit Langem nicht mehr aufgeführt.
Unendlich viele Almsagen und Erzählungen sind vom Kasmandl bekannt, das immer wieder in verschiedenster Gestalt in Erscheinung treten konnte und die seltsamsten Dinge vollbrachte.
Zu Martini am 11. November, wenn die Hütten verlassen liegen, soll dieser geheimnisvolle Berggeist, der besonders im Lungau beheimatet ist, dort Quartier beziehen und bis Georgi am 24. April ausharren. Auch Ignaz von Kürsinger erzählt in seinem Geschichtswerk „Der Lungau“ über diesen Almgeist:
„Im Lessachwinkel des Lungaus treibt sich das Käsmandel, ein kleines Männlein von eisengrauer Farbe, mit bleichem, runzligem Gesichte herum, das den Leuten manchen Schabernack spielt. Während des Sommers hält es sich auf den höchsten Bergspitzen, in unzugänglichen Wäldern auf und lebt von Wurzeln und Kräutern. Im Herbst aber, wenn die Senner die Alm verlassen und mit der Herde heimgefahren sind, dann kommt das Käsmandel aus seinem Schlupfwinkel hervor, sucht die Almhütten auf und sammelt da alles, was die Senner und Hirten weggeworfen, verloren oder zurückgelassen haben. Diese Überreste käset es dann und lebt davon den ganzen, langen Winter über. Im Sommer, zur Zeit der Auffahrt in die Almen, verlässt das Käsmandel die Almhütten wieder und kehrt in seine einsamen Schlupfwinkel zurück.“
HIER gelangen Sie zur Langtext-Version dieses Beitrags.
Almen waren und sind ein wichtiger Teil der Landwirtschaft. Die Intention der Almwirtschaft bestand darin, dass durch die Bewirtschaftung hochalpiner Regionen ein Großteil des Viehbestandes mehrere Monate hindurch von der Stallfütterung unabhängig wurde. Somit konnte fast der ganze Ertrag der Wiesen im Tal für die winterliche Stallfütterung aufgespart werden. Man zog im Sommer gewissermaßen mit dem Vieh dem Futter nach. Zuerst auf die Niederalm, dann auf die Hochalm. Bei manchen Bauern zog die ganze Familie mit. Bei größeren Almen, wie im Pinzgau, waren die Futterställe, wo Tiere und Heu untergebracht waren, üblich. Meist schlief auch der Großteil der bäuerlichen Familie dort.
Die Almhütte selber blieb dem Senner oder der Sennerin vorbehalten, die auch für die Milchverarbeitung verantwortlich waren. Heute sind die Almen in den meisten Fällen modern ausgestattet, die Milch wird von der Molkerei abgeholt und nicht mehr auf der Alm verarbeitet. Die Almwirtschaft trägt auch heute noch dazu bei, wertvolle Kulturlandschaft zu pflegen und zu erhalten, und sehr viele Almen in Salzburg sind auch beliebte Ausflugsziele für Wanderer.
Die Alm war ein Ort, der sich weitgehend der sozialen Kontrolle der Dorfgemeinschaft entzog, deshalb entwickelte sich auch das verklärte Bild der Almromantik. Bräuche wie Almauftrieb oder mehr noch der Almabtrieb sind heute beliebte Touristenattraktionen.
Sehr oft wird man mit Vorstellungen über das romantische Almleben konfrontiert. Dass das Almleben aber mit harter Arbeit verbunden war, darüber geben die Dokumentationen der Pinzgauer Almen im Salzburger Freilichtmuseum Auskunft.
Die Hasenhochalmhütte von den Kalbrunnalmen ist ein Rundumstallkaser, eine alte und seltene Entwicklungsform. Ausgangspunkt war ein Einraumbau (Kaser). In diesem Einraum wurde gewohnt und gewirtschaftet. Der Stall befand sich um diesen Raum. Die Almhütte, die nun im Freilichtmuseum steht, war bis 1999 bewirtschaftet, heute hat die Sennerin eine moderne Hütte – mit Hochdruckreiniger, Elektroherd und Fernseher – und kann mit dem Auto zufahren.
Die Wurfalm war das „Wohngebäude“ einer Alm aus Wald im Pinzgau. Der zugehörige Stall wurde durch den Futterstall des Oberfurtlehens, ebenfalls aus Wald im Pinzgau, ergänzt. Im Sommer sperrten die Besitzer der Wurfalm den Hof zu und gingen alle auf die Alm. Die Hütte blieb aber dem Senner oder der Sennerin vorbehalten, die Familie schlief im Futterstall im Heu. Ihre Aufgabe war es, die Almwiesen zu bewirtschaften. In mehreren Gesprächen mit den ehemaligen Besitzern konnte das Leben auf diesen Almen dokumentiert werden.
HIER gelangen Sie zur Langtext-Version dieses Beitrags.
In den Wärmeperioden nach der letzten Eiszeit drangen reitende Nomaden aus Asien mit ihren Rinder-, Schaf- und Ziegenherden bis nach Osteuropa, besonders ins heutige Ungarn vor, wo sie Verhältnisse antrafen, die denen in ihrer Stammheimat ähnlich waren. Ihre Kundschafter zogen weiter durch die Wälder und Auen des westlich anschließenden Berglandes und entdeckten schließlich weite Grasflächen oberhalb der Wälder. Sie benannten diese Bergweiden mit den Worten „Alp“ oder „Alb“.
In den folgenden Jahrtausenden kamen neue Zuwanderer aus dem Südosten und Süden auf die Bergweiden, deren Bezeichnung „Alpen“ sie übernahmen. Es kam zu einer Zusammenarbeit und gegenseitiger Ergänzung von Bergweide und Bergbau. Weitere Fortschritte gab es bei der Holzbearbeitung (Bauten und Zäune).
Klima und Vegetation des Berglandes, zusammen mit dem Stand der Wirtschaft führten dazu, dass auch die Kelten die Alpenwirtschaft übernahmen. Das Land östlich des Ziller und Inns übernahmen die Römer und machten es zur Provinz Noricum. Es entstanden allgemein Siedlungen, das Land wurde „ausgebaut“ und sowohl der Viehbestand als auch der Futterbedarf nahmen zu. Schwere Rückschläge für die Entwicklung der Siedlung gab es ab etwa 1350 durch einige Pestepidemien, später durch die Bauernaufstände und die Ausweisung der Protestanten.
Für die Bewirtschaftung und die Leistung der Almen/Alpen sind viele unterschiedliche Voraussetzungen zu bedenken. Von der Höhenlage ist besonders das Klima abhängig, das seinerseits auf das vorhandene Muttergestein einwirkt und so immer eine bestimmte Bodenbildung mit entsprechendem Pflanzenwuchs hervorbringt.
Die Hochalmen bringen mit ihren extremen Klimabedingungen, kurzer Vegetationszeit und artenarmer Vegetation einen viel geringeren Ertrag als die Mittel- und Niederalmen in den Hang- und Tallagen der Waldzone. Für Hochalmen ist auch oft ein Schneefluchtrecht verbrieft, das heißt: Bei Schneefällen darf das Vieh auf tiefer gelegene Weiden anderer Besitzer getrieben werden.
Hochalmen sind meist ziemlich groß und bilden als Einzelalmen organische Teile bestimmter Bauernhöfe. Für die Arbeit auf der Hochalm ist jedoch nicht jeder gleich geeignet, denn das Reizklima und der geringe Luftdruck stellen extreme Bedingungen dar. Unter Umständen kann dies jedoch die Gesundheit stärken, ein Hochgefühl vermitteln und manche Menschen sogar „bergsüchtig“ machen.
Für den Almbetrieb sind über die Weidemöglichkeiten hinaus gewisse „Almeinrichtungen“ notwendig; vor allem Gebäude, Wege, Einfriedungen und nicht zuletzt eine gesicherte Wasserversorgung. Als erstes braucht es hier Wege – am Anfang genügten einfache Triebwege und Steige, später schuf man Schleifspuren für Sommerschlitten und schließlich Fahrwege.
Als Unterkünfte dienten zuerst Einraum-Hütten in Stein und Holz, doch bald kam es allgemein zu einer Teilung in Küche, Keller und Stube. Das Vieh blieb früher vielfach den ganzen Sommer über im Freien. Später erlaubten Zäune auch die Unterteilung einer Alm, etwa in „Halten“ für Kälber, Jungstiere, Ochsen oder in eine Kuh- und Galtviehalm.
Wasser war und ist für Mensch und Tier und für viele Arbeiten in den Hütten zwingend notwendig, oft wird es auch für Bewässerungen oder zum Antrieb der „Rührkübel“ (Butterfass) eingesetzt. Meist ist es reichlich vorhanden – Almhütten stehen oft in der Nähe von Quellen oder Bächen –, manchmal muss es aber zugeleitet werden. Ansonsten waren die Bauern stets Selbstversorger. Erst mit der „industriellen Revolution“ gab es eine Umstellung auf die Marktwirtschaft, in der immer weniger Leute immer mehr andere versorgen sollen.
In den Städten besannen sich die neu Zugezogenen auf die Schönheiten der vorher verlassenen Heimat, sammelten sich in Geselligkeits-, Wander- und Gebirgstrachtenerhaltungsvereinen und veranstalteten ihre „Almpartien“.
Längst hatten auch Dichter und Maler die Großartigkeit und Romantik der vorher „schröcklichen Gepürge“ verkündet, und die ersten Bergsteiger suchten auf den Almhütten Unterkunft und Labung. So zog auf den Almen ein neues Leben ein. Früher hatte man auf den Almen noch selbstironisch gesungen: „Auf der Alm is´s koa(n) Bleibm / tuats bald regna bald schneibm.“
Entgegen aller Schwärmerei und der gelobten Freiheit des Almlebens ging (besonders nach dem Zweiten Weltkrieg) und geht auch heute noch die Zahl der Almleute zurück. Der Personalmangel ist jedenfalls ein auslösendes Moment – ohne Sennerin oder Melker kann man keine Melkkühe mehr auf die Alm geben. In manchen Fällen springen noch die alten Bauersleute ein, aber die können eine größere Herde nicht mehr betreuen und behelfen sich höchstens mit einer oder zwei Kühen für den Eigenbedarf.
Heute sind die Bauern mit dem Güllefass und der „Hüater“ mit seiner „Maschin“ auf dem Almweg nicht mehr allein. Denn die Nachkommen der Städter, die im 19. Jahrhundert die Berge entdeckt haben, ziehen so wie die Gäste aus aller Welt in Scharen auf die Almen. So manche Leute kommen auch mit ihren Familien oder Freunden immer wieder gerne auf die Almen und sind glücklich, wenn sie eine von den Hütten, die die Bauern nicht mehr benützen, mieten können. Immer mehr Almgeschäft „geht“ heute allerdings im Winter, denn die meisten Almen bieten von Natur aus ein ideales Gelände für den Wintersport.
Für viele Bräuche, die früher im Almleben wirklich gebraucht wurden, fehlen jetzt die Grundlagen – und vor allem die Leute und die Zeit. Vieles, was auf gute Nachbarschaft aufgebaut war, hat für eine anonyme Zuschauerschaft keinen Sinn. Doch auch heute noch gibt es Alm-Familien, die dem Besucher Zeit schenken und die in Vertrauen und Dankbarkeit ihr Tischgebet und Stallgebet halten. Alm- und Bergmessen werden von Einheimischen und Gästen besucht und mitgefeiert.
HIER gelangen Sie zur Langtext-Version dieses Beitrags.
Im Lungau liegt fast der ganze Almenbezirk über 1.000 Meter. Die Almen, die nun einmal zur bäuerlichen Wirtschaft gehören, liegen in den hinteren Winkeln der Seitentäler. Aus diesem Grund geht man „in die Alm“, nicht auf die Alm, und dann lebt oder arbeitet man nicht auf der Alm, sondern „in der Alm“ – so berichtigt Karl Santner, der aus eigener Kindheits- und Jugenderfahrung über das vorindustrielle Leben auf Lungauer Almen berichtet.
Mit vier Jahren wurde er das erste Mal in die Alm mitgenommen – was es da zu erforschen gab, war eine neue, andere Welt. Ein paar Sommer lang durfte er mitgehen und wurde in verschiedene Aufgaben eingeführt. Mit neun oder zehn Jahren begannen die ersten Pflichtübungen als „Gåltachhålter“ (Hirte des Jungviehs). Dabei konnte es oft sehr heiß werden, und es gab gleichzeitig keinen Monat, in dem es nicht bis auf 2.000 Meter oder ganz auf den Talboden herunterschneien konnte. Mit 15 und 16 Jahren stellte sich die Herausforderung, als „Hålter“ (Kuhhirte) zu arbeiten.
Der Höhepunkt des Almsommers war die Mahdzeit, wenn das ganze Gesinde des Hauses (= Hofes) für etwa drei Wochen „ins Måhd“ kam, um Heu zu machen für den Winter. Zu den letzten Arbeiten gehörte das Ablegen der Zäune, damit sie nicht durch den Schnee beschädigt wurden. Damit einher ging das „Aus-der Ålm-Fåhrn“, das je nach Wetter auf einen der ersten Samstage im Oktober („Goldene Samstage“) angesetzt war.
HIER gelangen Sie zur Langtext-Version dieses Beitrags.
Die Untersbergsage ist eine der zahlreichen Ausformungen des Mythos von der Wiederkehr des Herrschers am Ende der Zeiten. Die ersten für die europäischen Literaturen wesentlichen Verschriftlichungen von Mythen finden wir in der Bibel und bei antiken Schriftstellern (Schöpfungsmythen, große Flut usw.). Dazu gehören die Darstellungen von unverwundbaren Helden genauso wie die von unsterblichen Herrschern.
Der Mythos vom Ende der Welt hat im europäischen Mittelalter seine Voraussetzungen im Buch Daniel 2,31–45 und 7,1–27 sowie in der Johannes-Apokalypse 13,1–18 und 17,1–18. Durch Daniels Prophezeiungen entstand die Lehre von den vier Reichen, wobei das Römerreich als viertes und letztes vor dem Ende der Welt galt. Deshalb musste der deutsche König zum römischen Kaiser gekrönt werden, um die „Weltherrschaft“ innehaben zu können. Auch Jesus verstand sich als Künder des sich nahenden Reiches Gottes. Im 4. Jahrhundert n. Chr. entstand die Weissagung, dass auf die Herrschaft des letzten römischen Kaisers der Antichrist folgen würde. Dessen Herrschaft würde bis zur Erscheinung Christi und dem Jüngsten Gericht dauern. Im hohen Mittelalter – besonders beim Aufbruch zum zweiten Kreuzzug – war die Endkaiser-Erwartung besonders groß. Die Ankunft und die Selbstkrönung Friedrich II. 1228 im Heiligen Land wurde als Zeichen für den Endkaiser verstanden. Nach dessen Beisetzung (1250) erzählte man, der Stauferkaiser sei gar nicht gestorben. Bis in die Neuzeit blieb der Stauferkaiser als Mythos vom unsterblichen Herrscher lebendig. Im 13. Jahrhundert kommt ein neuer Mythos auf: Der Herrscher lebe bis zu seiner Wiederkehr in einem Berg verborgen.
Zum Mythos der Wiederkehr des Herrschers am Ende der Zeiten kommt zu Beginn des 13. Jahrhunderts die Vorstellung dazu, dass der Herrscher bis dahin in einem Berg verborgen lebe. Nach König Artus wurde auch Kaiser Friedrich II. in den Ätna bzw. auf einen Berg namens Kyffhäuser und weitere versetzt.
Verschiedene Schriften bezeugen mit ihren Varianten, dass die Sage zu „wandern“ begann. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts erreichte sie das Salzburger Land. 1557/58 berichtet Lazarus Gizner von Reichenhall, dass Kaiser Friedrich sich im Untersberg bei Salzburg aufhalte. Yvonne Weber-Fleischer[253] hat die Übertragung dieses Kaisermythos auf Karl den Großen und den Untersberg in der Neuzeit untersucht. Ihren Forschungen zufolge ist eine voll entfaltete Sage erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu finden, nämlich beim Stadtschreiber und Advokaten Martin Pegius in der Stadt Mühldorf.
In zahlreichen Varianten hat sich diese Untersberg-Endzeitsage in Sagenbüchern (so auch dem „Österreichischen Sagenschatz“) und bildlichen Darstellungen erhalten. Auch in Schaukästen mit bewegten Figuren (am Wallfahrtsort Maria Plain bei Salzburg, im Untersbergmuseumin Fürstenbrunn) wird die Sage dargestellt.
Eine literarische Bearbeitung von Untersbergsage und Endzeitkaiser bietet Valentin Pfeifenberger (1914–2004) mit seinem „Untersberg“[254]. Der Autor Pfeifenberger ist katholischer Priester, sowohl seine Lebensformen als auch seine religiöse Vermittlung sind unkonventionell.
Der Titel „Im Untersberg“ verweist auf jenen mythischen Ort, wo Kaiser Karl (oder Friedrich I. oder II.) auf die Zerrüttung der Welt und seinen entscheidenden Gang aufs Schlachtfeld (hier: das „Walserfeld“) wartet. Der Text gliedert sich in zwei Teile: 1. „Die Thomasnacht Europas“, 2. „Entwurf zum 2. Teil der Untersberger Johannisnacht“. Sowohl Thomas- als auch Johannisnacht sind im Volksglauben besondere Nächte, wo böse und gute Kräfte am Werk sind. Pfeifenberger stellt dem eigentlichen Text persönliche handschriftliche Briefe und Texte mit Illustrationen voran, die die angebliche Entstehungsgeschichte und das „1000jährige Reich“ von 962 bis 1962 nachzeichnen. Das Stück ist geprägt von jüdisch-christlichen Vorstellungen. Neben dem deutschen Kaiserreich spielen die Sowjetunion und die USA eine Rolle. Einerseits soll der Untergang der Kultur oder der Welt aufgehalten werden, andererseits wird mit dem Untergang die Hoffnung auf eine bessere Existenzform verbunden.
Den Figuren Hanswurst[255] und Pudlpudl, seiner Gefährtin, kommt die Aufgabe zu, das Stück aufzulockern. Neben dem im Stück die Rolle eines dominierenden Dieners einnehmenden Hanswurst bekommen den Kaiser verschiedene Figuren zu sehen (darunter Lazarus von Reichenhall).
Leider hat der Autor einer Aufnahme des Textes in die elektronische Neuauflage nicht zugestimmt.
HIER gelangen Sie zur Langtext-Version dieses Beitrags.
Ein glücklicher Zufall hat die späte Version der bekannten Unterbergsage unter den politischen Verwaltungsakten der Salzburger Landesregierung des Jahres 1900 überliefert[256]. Zensur und Vorzensur waren zwar im franziskojosephinischen[257] Österreich abgeschafft, aber die öffentlichen „Productionen“ bedurften der Konzessionierung (behördliche Genehmigung).
Ein Untersbergspiel war der Behörde noch nicht vorgekommen, sie forderte daher den ganzen Text. Es handelt sich um eine einfache Überlieferung. Der Schreiber Josef Graf, ein Maurer, hatte zwar eine gelenke Hand, aber eine miserable Feder und wenig Zeit. Er setzt sich hin und bringt das Spiel zügig zu Papier. Dem Spiel liegt vermutlich eine (hand)schriftliche Fassung zugrunde, doch die vorliegende Überlieferung erinnert eher an ein Schreiben aus dem Stegreif. Da kennt jemand sein Drehbuch, hat es mit seiner Truppe gut eingelernt und vielleicht schon illegal gespielt.
Die vier Figuren – Hanswurst, Kaiser, „altes Weib“, Untersbergmandl – wurden von drei Personen dargestellt. Die Kostümierung hielt sich an standardisierte Darstellungsformen solcher Typen. „Der Kaiser Karl trägt einen langen Mantel, Papierkrone, hölzernes Schwert, wallenden Bart. Der Hanswurst trägt eine rothe Jacke mit Spitzen besetzt und eine Papierkappe. Das Untersbergmännchen trägt eine steingraue Kaputze und solchen Bart, wogegen das alte Weib in bäuerlicher Tracht auftritt“, so ermittelte das k. k. Bezirks-Gendarmerie-Commando.
Das Untersbergspiel aus dem Jahre 1900 reduziert den überlieferten „Sagenstoff“ auf eine fiktive Begegnung der Erzählfigur Hanswurst mit den Mächten des Untersberges, Kaiser Karl, einer „alten Frau“ und einem Untersbergmandl. Im ersten Auftritt erinnert Hanswurst das Publikum an die Sage vom Weltuntergang als Folge einer dreitägigen Hammerschlacht auf dem Walserfeld. Das „alte Weib“ beklagt im nächsten Auftritt den Verfall der Welt durch die sündige Menschheit. Sodann gibt Kaiser Karl dem angekündigten Gericht einen alttestamentarischen Charakter von göttlicher Strafe am ungläubigen Volk. In deftigen Ausdrücken artikuliert Hanswurst seine Angst vor einem solchen starken kaiserlichen Auftritt. Doch als „Narr“ kann er sich im folgenden Zwiegespräch mit einem Untersbergmandl auch allerhand Unhöflichkeiten gegen die Untersberger Sippschaft erlauben. Dann distanziert er sich von der ganzen schrecklichen Prophezeiung des Weltunterganges, indem er die Untersberger auf Dauer in ihren Berg verbannt, und zuletzt überhaupt die ganze Geschichte als bloßes Gedicht und Fabel demaskiert.
Das ist seine ganze Wahrheit – als Narr. Immerhin stehen wir am Beginn des 20. Jahrhunderts. Wirklich Recht hatte nicht mehr die Volksüberlieferung, sondern die Illusionsfabrik der Geschichtenerzähler im Dienste der Nation. „Das Kaiser-Karl-Untersbergspiel dürfte sich als ein Salzburger Nationalspiel darstellen“, fasste das k. k. Bezirks-Gendarmerie-Commando Salzburg zusammen. Das Stück wurde daher in bäuerlicher Salzburger Mundart vorgetragen. Doch innerhalb dieser „volkstümlichen“ Zuordnung verwendet Hanswurst eine geradezu gekünstelt korrekte Dialektvariante mit den Identifikationsformen „en(k)s“ und „öbbas“, während Kaiser Karl, die „alte Frau“ und das Untersbergmandl sich der deutschen Hochsprache annähern.
Was den sozialen Kontext des Untersbergspiels aus dem Jahre 1900 anbelangt, so pflegte das Bezirks- Gendarmerie-Commando keine romantischen Vorstellungen. „Sowohl dieses Spiel, als auch die sonst gebräuchlichen Spiele, als Sternsingen, Sommer- und Winterspiel, Hirtensingen u.s.w. stellen sich im allgemeinen als nichts anderes als ein concessionierter Bettel dar“. Die drei Spieler sind sämtliche „Maurer von Profession und leben in ziemlich gedrückten Verhältnissen“, alle verheiratet, mit drei bzw. zwei und einem Kind.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kronlandes Salzburg waren zur Jahrhundertwende ganz günstig. Maurer fanden in der Baukonjunktur dieser Jahre annähernd gute Beschäftigung. Doch dem arbeitsreichen Sommer folgten die arbeitslosen Wintermonate – und diese wollten die Antragsteller durch ihr „Untersberg-Spiel von Haus zu Haus“ überbrücken, um „damit den Lebensunterhalt auf ordentliche, reelle Weise zu verdienen“. Der formelle Antragsteller Josef Graf war in Kleingmain wohnhaft. Die beiden anderen waren Zuzügler im wirtschaftlichen Hoffnungsgebiet Salzburg: Richard Mosbacher, Jahrgang 1854, kam aus Mauerkirchen im Innkreis; Florian Binder, Jahrgang 1854, von weit her, aus Kirchbach im niederösterreichischen politischen Bezirk Zwettl – wer dort im oberen Waldviertel überleben will, muss bis heute auspendeln oder abwandern. So finden wir sie vereint diese drei Maurer aus drei Kronländern beim Salzburger Nationalspiel.
HIER gelangen Sie zur Langtext-Version dieses Beitrags.
Im ehemals fürstlichen Berchtesgaden gibt es eine Fülle an Bräuchen, die von der Bevölkerung im Alltag lebendig gehalten wird, wie der Kreisheimatpfleger Franz Schned aufzeigt. Wenn am 6. Januar die Heiligen Drei Könige verkleidet mit einem Stern von Haus zu Haus zu gehen, beginnt das Brauchleben im Jahreszyklus. Besonders die vom Wetter abhängige bäuerliche Bevölkerung sehnt langsam das Frühjahr herbei. Um Lichtmess (2. Februar) herum ist der Tag schon um eine Stunde länger hell. Maria Lichtmess war früher ein hoher Feiertag und ein sogenannter Lostag. Knechte und Mägde haben an diesem Tag die Arbeitsplätze gewechselt oder wieder für ein Jahr vereinbart, ebenso wurde der Jahreslohn ausbezahlt.
Im Fasching geht’s beim „Habergoas-Austreibn“, „Hohschlien-Renna“ und der „Berchtesgadener Faschingsgilde“ lustig zu. Besonders reich an Tradition ist die Fastenzeit, insbesondere die Karwoche mit dem Ostersonntag als wichtigster Feiertag. Auch Fronleichnam, Erntedank und Allerheiligen werden in traditioneller Weise begangen.
Ebenso gefeiert werden die Gedenktage des heiligen Valentin (14. Februar), des heiligen Matthias (24. Februar), der heiligen Kunigunde (7. März), des heiligen Josef („Josefi“, 19. März) und des heiligen Markus (24. April). Besonders beliebt sind die Bräuche um den 1. April („Bären aufbinden“) und den Ersten Mai (Maibaumaufstellen).
Der Berchtesgadener Fasching ist nicht mit den karnevalistischen Schauveranstaltungen vergleichbar. Trotzdem spielt er eine nicht weniger bedeutende Rolle im Alltagsjahr. Eine der Besonderheiten ist das „Habergoas-Austreibn“ (Gnotschaft Loipl, Gemeinde Bischofswiesen). Bei gutem Wetter findet diese Veranstaltung immer im Freien statt. Die übers Jahr bekannt gewordenen „Moritaten“ werden von vielen Zuschauern mit Spannung erwartet.
In die Zeit des Faschings fällt auch das „Hohschlien-Renna“ am Eggerfeld in Bischofswiesen, veranstaltet vom örtlichen Trachtenverein „DʼWatzmanner“. Für viele Faschingsvorkommnisse im Markt ist die „Berchtesgadener Faschingsgilde“ zuständig. Die Gilde feiert mit Tanzgruppen, Musikkapellen, auswärtigen Faschingsgilden aus nah und fern mit begeistertem Publikum im Kur- und Kongresshaus im Markt Berchtesgaden das faschingsgesellschaftliche Ereignis.
In Berchtesgaden kennt man auch das sogenannte Faschingeingraben. Diese Faschingbeerdigung findet am Faschingdienstag ab Mitternacht statt. Abwechselnd in verschiedenen Gastwirtschaften wird mit Trauer und Wehklagen in einem dramatischen Leichenzug der durch einen Mann verkörperte Fasching nach einer bestimmten Zeremonie beerdigt.
Das Osterfest im engeren Sinn beginnt mit dem Palmsonntag, an dem in den Kirchen mit feierlichem Hochamt die Palmbuschen geweiht werden. Seit einigen Jahren wird die Palmweihe verschiedentlich im Freien vor der Kirche oder wie in Markt Schellenberg im Schulgebäude vorgenommen. Im bäuerlichen Bereich werden drei geweihte Palmbuschen gebraucht. In der Regel kommt einer aufs Feld und der zweite kommt ins „Oidarl“ (Hausaltar im Herrgottswinkel), ein dritter wird unterm Dachfirst am Wirtschaftsgebäude untergebracht, damit Haus, Hof und Ernte gleichermaßen gesegnet und geschützt seien.
Am Gründonnerstag „fliegen die Glocken nach Rom“. Sie verstummen bis zum Karsamstag bzw. Ostersonntag früh zur Auferstehung und werden in der Zwischenzeit von den sogenannten Karfreitagratschen ersetzt. Zur gleichen Zeit wird in einigen Gemeinden das „Heilige Grab“ aufgebaut.
Am Karsamstag war früher um 6 Uhr die Osterfeuerweihe am Kirchplatz (heute etwas später). Seit dem 2. Vatikanischen Konzil wird um 5 Uhr früh oder am Abend des Karsamstags die Auferstehung als Osterfeier mit Speisenweihe begangen. Der Karsamstag ist, wie der Karfreitag, ein Fast- und Abstinenztag. Nach der Auferstehungsfeier wird das Osterlicht mit nach Hause genommen und in den Herrgottswinkel als geweihtes Kerzenlicht gestellt. Die geweihten Speisen wie Brot, Butter, Salz und Eier werden zum Frühstück gegessen. Manchmal bekommen sogar die Tiere im Stall etwas von dem geweihten Brot zu fressen.
Die Fronleichnamsschützen Schellenberg e. V. sind eine Besonderheit in Bayern und haben ihre Tradition erhalten. Der Ursprung des Vereins geht in das 17. Jahrhundert zurück. Er ist aus einer Bürgergarde hervorgegangen, die seinerzeit die Aufgabe der Landesverteidigung wahrzunehmen hatte. Die Fronleichnamsschützen nehmen an den Prozessionen zu Fronleichnam (großer und kleiner Prangertag) und am Erntedankfest teil.
Die Königlich-Privilegierte Feuerschützengesellschaft Berchtesgaden besteht seit mehr als 340 Jahren. Zahlreiche Veranstaltungen sprechen für das ganzjährige gesellschaftliche Leben der Schützengesellschaft – wie die Vereinsmeisterschaft, die Königsfeier (Verleihung der Königswürde an die neuen Schützenkönige) oder das „Martini-Schießen“.
Die Königlich-Privilegierte Feuerschützengesellschaft Ramsau hatte im Jahr 2000 ihr 250-Jahr-Jubiläum. Ihre Fahne zeigt die Pfarrkirche Ramsau mit der Reiteralm im Hintergrund. Als Brauchträger wahren auch sie, wie die Berchtesgadener Feuerschützen, die Tradition des Schützenwesens mit einem sehr lebendigen Vereinsjahr. Gesellschaftlich beteiligen sich die Mitglieder sowohl bei kirchlichen Festen (Fronleichnamsprozession, Feldgottesdienste) als auch bei weltlichen (Faschingsumzüge).
Im Mittelpunk steht am Ersten Mai in Schönau am Königssee, Winkl, Oberau, Buchenhöhe und Oberstein/Markt Schellenberg das Maibaumaufstellen bei verschiedenen Gasthäusern. Im Markt Berchtesgaden zum Beispiel stellen die Eisstockschützen für die Marktgemeinschaft einen Maibaum auf, der nicht selten an die 30 Meter hoch ist. Das Fest wird von der Marktgemeinschaft ausgerichtet. Den Höhepunkt der Veranstaltung stellt das traditionelle Maibaumkraxeln dar, beim dem versucht wird, die am Baum hängenden Preise zu erlangen.
Ein besonderer Maibaum ist jener, der auf der Spitze des Kleinen Barmstein aufgerichtet wird. Dieser wird nicht alle Jahre neu aufgestellt, nur wenn ihn ein Blitzschlag beschädigt oder gar zerstört. Besonders schwierig ist der Transport auf die steilen Felszacken, das Aufstellen selbst erfordert noch mehr Geschicklichkeit. Der Baumstamm wird mit Löschtalk weiß gestrichen und aufgekranzt, so ist er weit sichtbar. Am fertigen Maibaum wird noch ein Kreuz befestigt, das zur Wallfahrtskirche in Dürrnberg zeigt.
Die Geschichte rund um den Maibaum auf dem Kleinen Barmstein beginnt mit der Kurfürstin Marie Leopoldine, die 1815 um „150.000 Gulden von der bayerischen Finanzverwaltung die Brauerei Kaltenhausen am Fuß der Barmsteine [kaufte]. Da erwiesen die Burschen von Kaltenhausen der neuen Besitzerin ihre Reverenz durch einen Maibaum am Kleinen Barmstein. Die Kurfürstin bedankte sich mit einem Faß Bier. Seit dieser Zeit wird jährlich unter beträchtlichen Erschwernissen am 1. Mai der Baum auf dem Felsgipfel erneuert.“[259]
Je nach Witterung und je nachdem wie die Weide bestellt ist, wird Anfang Juni bis September das Vieh auf den Almen „gesömmert“. Die Almwirtschaft im historischen Berchtesgadener Land, also südlich des Hallthurm, blickt auf eine über tausend Jahre alte Geschichte zurück (im 8. Jahrhundert sind die Almen „Gauzo“ und „Laduso“ urkundlich erwähnt).
Am Tag „gen Almfahrn“ (Almauftrieb) wird das Vieh von dem Bauern mit Weihwasser besprengt, während die weiteren Familienmitglieder um den Almsegen beten. Auf der Alm angekommen, werden dem Vieh die großen Glocken abgenommen und die sogenannten Weideglocken angelegt. Nachdem das Vieh versorgt ist und die Sennerin den Wohnteil eingerichtet hat, wird das „Kasstöckl“ (Wohnteil mit Herd) „aufglatscht“ (mit Latschenzweigen ausgeschmückt). Der mühevolle Alltag auf der Alm kann nun beginnen. Die Kühe werden in der Früh und am Abend gemolken, die Milch muss verarbeitet oder in die Molkerei transportiert werden, der Stall wird täglich entmistet, das Brennholz muss gemacht werden, Almwanderer werden bewirtet.
Wenn das Futter in der Waldweide weniger und der Wind rauer wird (um „Baschtlmä“, 24. August), dann werden die Vorbereitungen für den Almabtrieb getroffen. Das „Fuikl“ ist der schönste und kostbarste Viehschmuck beim Almabtrieb im historischen Berchtesgadener Land. Zum Almabtrieb werden Mithelfer mit viel Gespür für die Tiere gebraucht. Das Vieh wird mit Weihwasser besprengt, um für einen unfallfreien Almabtrieb gewappnet zu sein. Den Tieren wird anstelle der Weideglocken das Almgeläute umgelegt. Dieser Klangkörper verkündet von Weitem schon den Einzug der „Almer“ ins Dorf, wo den Tieren der Almschmuck abgenommen und zur Besichtigung aufgestellt wird.
Die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft hat mit dem „Bauernherbst“ eine Blitzidee ins Leben gesetzt: Feiern wie die Bauern im Herbst, wenn die Mahd vorbei und die Landwirtschaft auf Winterbetrieb eingestellt ist. Da wurde zum Tanz aufgespielt, da hatten Bauersleute und Gesinde füreinander Zeit, da wurde aufgekocht und gefeiert – Erntedank gewissermaßen.
Und weil diese Feierkultur abgekommen ist, die Menschen wohl mobiler, sich damit auch fremder geworden sind, war ein Impuls zum Zusammenrücken, zum Miteinander-Feiern, Tanzen und Singen, zum gut Essen und Trinken nur recht. Gäste von auswärts sollten bei dieser Gelegenheit den Bauersleuten über die Schulter blicken dürfen, selbst einmal einen Volkstanz, einen Plattler versuchen und „Schmankerl“ aus Pfanne, Rein oder Schüssel verkosten können. Sie sollten sich bei den Bauersleuten wohlfühlen und nach Möglichkeit auch extra ins „kleine Paradies“ kommen. Wie die vielen, die zum Törggelen nach Südtirol oder zum Junker-Verkosten ins Steirische fahren.
Eine Untersuchung hat ergeben, dass 96 Prozent der heimischen Bevölkerung der Bauernherbst ein Begriff ist. Zwei Drittel der Bevölkerung haben schon an Bauernherbst-Veranstaltungen teilgenommen. Drei Viertel der Besucher sind Einheimische, ein Viertel Touristen. Hervorragende Zahlen, großartige Werbebilanz. Dennoch gab es auch negative Kritik. Wohl gibt es eine grundsätzliche Philosophie, dass nichts neu erfunden werden müsse und das Maß an alten bäuerlichen Herbstfesten zu nehmen sei, aber Bauernkrapfen, Strohpuppen und Ziachspieler sind nur ein Teil des kulturellen Lebens im Lande.
Salzburg wurde im Rahmen des „Bauernherbstes“ zum Land der Bauernkrapfen und Pofesen, zum Land der Strohpuppen und Bauernherbstfahnen, der „Schmankerl“-Olympiaden, der Ziachspieler und Plafondtuscher. Ja, das alles gibtʼs im Lande. Und das ist gut so. Aber das ist nicht alles, was das kulturelle Leben in diesem Lande ausmacht. Gewiss stimmt es festlich, die ländliche Bevölkerung in ihren schönen Trachten zu bestaunen – und nicht nur sie. Es ist durchaus erfreulich, dass Trachten erneuert und wieder tragbar geworden sind. Aber der Bauer ist nicht einer, weil er in Lederhose und Lodenjanker dasteht, und die Bäuerin, weil sie im Dirndl, im rupfernen Werch und in selber gʼstrickten Strümpfen am heißen Herd steht.
Inzwischen tragen auch die Bauersleute andere Kleidungen und das Moderne ist nicht mehr der Stadt vorbehalten. Junges Landvolk unterscheidet sich nicht mehr von städtischen Altersgenossen. Das mag man bedauern, aber es ist so. Bis in die letzten Regionen des Landes hat sich herumgesprochen, dass Kasnocken, Kasspatzen, „bachene Mäus'“ und Pofesen, Speck und viel Schweineschmalz die Kraftnahrung früherer „Kraftlackeln“ waren. Dem ländlichen Menschen von heute wird aber auch zunehmend klar, dass bewusste Ernährung lebensverlängernd sein, gut munden und vor allem auch körperliches Wohlbefinden schaffen kann.
In der heutigen Zeit haben Bauersleute das alte Arbeitsgut zu schätzen und zu achten gelernt, indem sie es aufbewahren oder einem Heimatmuseum schenken, um es vor dem Verfall zu retten. Dies ist nur eine Seite der ländlichen Kultur. Mehr als früher erkennen die Menschen auf dem Lande ihre schöpferischen Fähigkeiten, beteiligen sie sich an Schreibwerkstätten, wagen es, ihre Ergebnisse von Malkursen oder anderen Kreativseminaren in der Öffentlichkeit vorzustellen. Es mehren sich Ausstellungen, Theateraufführungen, Leseforen und Konzerte mit zeitgenössischen Inhalten und Melodienführungen werden in hoher Qualität durchgeführt.
Gerade im musikalischen Bereich zeigt sich ein großer Wandel. Es ist und war nicht schlecht, sich an Überliefertem zu versuchen und das überlieferte Repertoire hochzuhalten und zu ehren. Durch immer besser ausgebildete Instrumentalisten in den Musikkapellen und anderen Ensembles verschwimmen die Grenzen zwischen überlieferter Volksmusik und Klassik. Gut muss die Musik sein, die Qualität ist ihr wesentlicher Maßstab.
Der Bauernherbst im Land Salzburg ist heute ein „Sammelsurium“ sämtlicher auf dem Lande stattfindender Veranstaltungen: Da schwindeln sich sogar kirchliche Feste wie der Erntedank als Bauernherbstimpuls in die Programmhefte hinein. Als ob Erntedank heute nur mehr Sache der Bauern und vor allem Sache des Tourismus wäre.
Menschen in ländlichen Gegenden und Betrieben, in Landwirtschaft, Büro, Gastronomie, Handel und Industrie wehren sich zunehmend gegen das so gezeichnete Bild einer herbstlichen Bauernkultur. Ihre Kritik soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Vieles ist gut und erfreulich an den Bauernherbst-Veranstaltungen und dem Zusammenleben der Menschen – der Gäste wie der Einheimischen – dienlich. Doch vieles ist überspitzt, einseitig, verzerrend und verfälschend.
„Alles was geschieht, geht von den Orten und Regionen aus“, sagt „Mister Bauernherbst“, Karl Riegler. Die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft empfinde sich als Impulsgeber und Koordinator. Es wird an den Orten, Regionen und am Impulsgeber liegen, ob der Bauernherbst zum glaubwürdigen Fest der Menschen auf dem Lande wird oder zu einer oberflächlichen „M-ta-ta-Gaudi“ absinkt. Der Zulauf zu den Bauernherbstveranstaltungen ist groß, aber nicht alles ist richtig, was und wie es den Massen gefällt.
[248] Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug aus dem im Verlag Anton Pustet 2002 erschienenen Buch „Almsommer“ von Walter Mooslechner. Sie können dieses Buch unter folgender E-Mail-Adresse: buch@verlag-anton-pustet.at bestellen.
[249] Ein bedeutender Säumerweg führte über den Heiligbluter Tauern durchs Seidlwinkeltal nach Rauris. Wie in den übrigen Salzburger Tauerntälern, vom Pass Thurn bis zum Radstädter Tauern, sicherte auch hier ein Tauernhaus, das den Reisenden Unterkunft und Verpflegung gewährte, den gefahrenreichen Übergang nach Süden.
[255] Das äußere Kennzeichen von Hanswurst, dem Salzburger, der sich auf den Wiener Theaterbühnen niedergelassen hat, ist die Lungauer Tracht. Hanswurst war ein Sauschneider, daran erinnern der Hut mit dem weißen Flaum und Werkzeug am Gürtel.
[256] Landesarchiv Salzburg, Landespräsidium Zl.2772/1900.
[257] Benannt nach dem österreichischen Kaiser Franz Joseph (1830–1916).